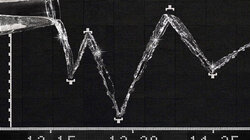Adam Smith
(1723–1790)
Manche Religionen haben Hunderte Propheten, die Gläubigen des freien Marktes hingegen brauchen nur einen: Adam Smith. Smith, ein Moralphilosoph aus Schottland, gilt als Begründer der klassischen Volkswirtschaftslehre und legte schon vor dem Entstehen des Kapitalismus dessen wichtigstes Gesetz überhaupt vor, nach dem sich noch heute viele Ökonomen, Börsenhändler und Manager richten: Der Markt kann alles regeln. In seinem 1776 erschienenen Buch Wohlstand der Nationen beschrieb Smith, wie das geschieht: Indem jeder Einzelne nur zum eigenen Vorteil handelt, wirkt sich der geballte Egoismus aller zum Nutzen der gesamten Gesellschaft aus, das Ergebnis der Egoismen ist das Gemeinwohl. Im Gleichgewicht gehalten wird diese natürliche Ordnung von der „unsichtbaren Hand“. Sie sorgt dafür, dass alle zur Verfügung stehenden Mittel wie Arbeitskräfte oder Rohstoffe optimal genutzt werden, was allen zugute kommt. Das heißt: Werden heute Tausende Beschäftigte eines Unternehmens entlassen, haben einzelne Firmen ein Monopol auf ein bestimmtes Produkt, wenn Bestechung zum Geschäft gesamter Wirtschaftszweige gehört, könnten die Anhänger Smiths weiter argumentieren, dass der Markt, eben weil er funktioniert, diese Unregelmäßigkeiten im weiteren Verlauf korrigieren wird. Diese unsichtbare Hand benötigt jedoch Spielraum. Daher sehen es Smiths Anhänger nicht gern, wenn der Staat eingreift und Märkte reguliert, er soll nur für geordnete Rahmenbedingungen sorgen. Der einzelne Mensch, der für den eigenen Vorteil arbeitet, kann nämlich besser beurteilen, was in jeder Situation das Beste ist, schrieb Smith. Zentral für Smith: Nach seiner Meinung ist die vom Volk geleistete Arbeit die Quelle des Reichtums einer Nation. Die Produktivität dieser Arbeit lässt sich steigern, indem die Arbeitsteilung beherzigt wird: Ein Arbeiter spezialisiert sich auf gewisse Tätigkeiten und kann so in kürzerer Zeit eine höhere Produktivität erreichen. Diese Arbeitsteilung gilt innerhalb eines Betriebes ebenso wie international.
So weit, so kühl eigentlich das Menschenbild, nach dem sich die Wirtschaft richtet und sich darin auf Adam Smith berufen kann. Dabei hatte Smith in seinen früheren Schriften das Gegenteil beschrieben; für ihn war die Sympathie der Ursprung menschlichen Handelns, die Anteilnahme am Schicksal des Nächsten das, was den Menschen menschlich macht. In dem Buch, das Smith selbst als sein eigentliches Hauptwerk bezeichnete, Theorie der ethischen Gefühle (1759), fragte er danach, wie denn Nächstenliebe und Mitgefühl, normaler menschlicher Umgang also, überhaupt möglich sein könne. Seine These: Die Menschen sind im Grunde gut. Jeder Mensch hat durch die Beobachtung anderer ein Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist. Wenn jemand moralisch und rechtmäßig handelt, wird sein Verhalten von den anderen Menschen akzeptiert. Wenn es aber nur seinem eigenen Nutzen dient, wird es verurteilt. Das hört sich zunächst nach einem Widerspruch zum Egoismus an, den Smith am Markt fordert. In der Wirtschaftsfachliteratur wird dieser Widerspruch auch als „Adam-Smith-Problem“ bezeichnet. Aber eigentlich heißt das nur, dass etwas zuerst moralisch einwandfrei sein muss, bevor ein eigener Nutzen verfolgt werden darf. Mit der „unsichtbaren Hand“ möchte Adam Smith also nicht persönlichen Egoismus rechtfertigen, sondern die Sympathie für die anderen Menschen erwecken, damit der Egoismus nicht egoistisch bleibt, sondern wirklich allen nützen kann.
Karl Marx
(1818–1883)
„Nach uns die Sintflut, ist der Wahlspruch jedes Kapitalisten und jeder Kapitalistennation“, schrieb Karl Marx in Das Kapital. In seinem dreibändigen Hauptwerk, dessen erster Band 1867 erschien, macht er den Versuch, die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus zu entschlüsseln und die grundlegenden Abhängigkeiten und Machtverhältnisse in einer kapitalistischen Gesellschaft darzustellen.
Ein wichtiger Begriff ist für Marx der des Mehrwerts, der nicht durch Gewinne beim Kauf und Verkauf von Waren entstehe, sondern dadurch, dass Kapitalisten die Arbeitskraft des Proletariats ausbeuten. Ein Arbeiter produziere durch seine Arbeit mehr Wert, als seine Arbeitskraft koste, weil er sie nach den Vorgaben „der herrschenden Klasse“ einsetzen müsse. „Seine Arbeit ist daher nicht freiwillig, sondern gezwungen“, schrieb Marx im Manifest der Kommunistischen Partei (1848). Die Abschaffung ungleicher Eigentums-
verhältnisse sah Marx als Schlüssel für eine gerechte Gesellschaft. Wird das Privateigentum abgeschafft, verschwinden auch die Klassengegensätze, so Marx. Außerdem werde das kapitalistische System zwangsläufig aus wirtschaftlichen Gründen zusammenbrechen.
1989 schien die Berliner Mauer mit der DDR auch das Marx’sche Denken unter sich zu begraben: Der Sozialismus des Ostblocks als Gegenentwurf zum Kapitalismus war gescheitert, die von Marx prophezeite klassenlose Gesellschaft ohne Unterdrückung eine Illusion geblieben. Doch der Kapitalismus neoliberaler Prägung verhilft Marx zu neuer Popularität. Seine These, dass der durch freie Märkte geprägte Kapitalismus die Arbeiter ausbeute („Das Kapital ist verstorbne Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit und um so mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt“), ist angesichts gewaltiger weltweiter Finanzströme und der internationalen Verschiebung von Arbeitsplätzen für viele wieder aktuell.
John Maynard Keynes
(1883–1946)
Der britische Ökonom John Maynard Keynes krempelte die Wirtschaftswissenschaft und
-politik im 20. Jahrhundert nachhaltig um. „Der Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen Überzeugung, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden“, hat er einmal gesagt. Die von Adam Smith postulierte „unsichtbare Hand“ des Marktes, welche Angebot und Nachfrage genau wie Vor- und Nachteile quasi automatisch in ein Gleichgewicht bringe, hielt Keynes schlichtweg für Unsinn: Wenn nötig, beispielsweise bei Nachfragelücken, sollte sich der Staat in die Marktwirtschaft einmischen und Geld investieren – und dafür im Notfall auch Schulden machen. Denn es war die Nachfrage, die Keynes als den bestimmenden Faktor der Wirtschaft definierte. In den wirtschaftlich guten Zeiten des Aufschwungs sollten die vorher gemachten Schulden dann wieder beglichen werden.
Lohnsenkungen, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, lehnte der Ökonom ab. Denn: Wenn die Arbeiter ein geringeres Einkommen haben, können sie weniger konsumieren. Die Konsequenz daraus ist simpel: Die Nachfrage nach Gütern sinkt. „So kann das vermeintliche Heilmittel gegen Arbeitslosigkeit sich als Gift entpuppen“, schreibt Keynes in seinem Werk Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes (1936). Auch das Sparen – „einzelwirtschaftlich gesehen eine Tugend“ – entfalte gesamtwirtschaftlich einen negativen Effekt, weil so wieder ein Teil des Einkommens nicht für den Konsum zur Verfügung stehe. Keynes’ Formel: Sparen gleich Volkseinkommen minus Verbrauch. Übrigens: Das berühmteste Zitat des Ökonomen, mit welchem er das blinde Vertrauen in den Markt und die Hoffnung, dass sich Ungerechtigkeiten auf lange Sicht ausgleichen würden, attackierte, lautet: „Auf lange Sicht sind wir alle tot.“
Milton Friedman
(1912–2006)
„Die soziale Verantwortung der Wirtschaft ist es, ihre Profite zu vergrößern“, hat Milton Friedman gesagt. Und auch: „Es ist unmoralisch, Geld von den Reichen zu nehmen, um es den Armen zu geben.“ Kein Wunder, dass Friedman nicht nur Freunde hatte. Der in New York geborene Wirtschaftswissenschaftler gilt als einer der einflussreichsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts und als heftiger Keynes-Kritiker. Für Friedman gehörten Kapitalismus und Freiheit zusammen wie Topf und Deckel. Daher setzte er auf das freie Spiel von Angebot und Nachfrage. Seine Auffassung: Um die bestmögliche Versorgung der Bürger mit Geld, Arbeit und Gütern zu gewährleisten, soll sich der Staat vom Markt so fern halten wie irgend möglich. Die individuelle Freiheit sei ein „viel stärkerer Motor als jegliche staatliche Vorgabe“, schreibt Friedman in seinem Bestseller Kapitalismus und Freiheit (1962). Der Staat hat für Recht, Ruhe und Ordnung zu sorgen und den Wettbewerb zu fördern. Mehr nicht. Den Wohlfahrtsstaat betrachtete er als Feind der Wirtschaft. Das von Ludwig Erhard 1948 eingeläutete deutsche Wirtschaftswunder wertete Friedman als bestes Beispiel dafür, was die freie Marktwirtschaft zu leisten in der Lage sei.
Für seine „Monetarismus-Theorie“, nach der die Finanzpolitik über die Geldmenge kontrolliert werden soll, also über ein langsames, aber stetes Wachstum derselben, erhielt Friedman 1976 den Nobelpreis. Friedman war auch geis-tiger Vater der „Chicago Boys“, einer Gruppe neoliberaler Wissenschaftler, die seine Lehren in der Welt verbreiteten. Er beriet Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Kritik – etwa, weil er den chilenischen Diktator Augusto Pinochet beriet – prallte an ihm ab. Friedman sah seine Lehren stets bestätigt. Nicht zuletzt durch den Zusammenbruch des Sozialismus. Einer breiteren Öffentlichkeit stellte er seine Theorien mit dem Bestseller Chancen, die ich meine (1980) vor – er diente als Vorlage für eine populäre TV-Serie über die Ideen der freien Marktwirtschaft.