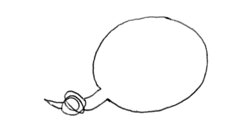Den Sprachwissenschaftler Harald Haarmann, 64, zu erwischen, ist nicht ganz einfach – schließlich ist er ständig rund um die Welt unterwegs, um dem Rätsel der Sprachen auf die Spur zu kommen. Eben noch in Kalifornien unterwegs, meldete er sich plötzlich von den Fidschi-Inseln. Nach Finnland, wo man ja eine äußerst interessante Sprache mit einer geballten Häufung von Umlauten spricht, zog er aber nicht der Wissenschaft wegen – sondern weil er sich einst in eine Finnin verliebt hatte. Obwohl er die Sprache damals noch gar nicht so gut konnte.
fluter: Wie kam die Sprache überhaupt in die Welt?
Haarmann: So eine Art Big Bang wie bei der Entstehung des Universums gab es da nicht. Die Sprache kam in Schritten zu uns. Schon die Hominiden, also die frühen Menschenaffen, haben mit Händen und Füßen kommuniziert. Das waren soziale Wesen in einer Gruppe, die sich mit den anderen verständigten. Zu den Gesten kamen dann Sprachlaute hinzu – weil die Lebensbedingungen komplexer wurden und so die Ansprüche an die Kommunikation zunahmen. Wenn ich nur Nahrung sammle, reicht es, am Lagerplatz zu gestikulieren. Wenn ich aber anfange, große Tiere wie Mammuts zu jagen, dann geht das nur in der Gruppe. Das heißt, alle müssen sich darüber unterhalten, wie man die Falle baut, wer wann was macht und wie man Fleisch, Knochen und Fell später nutzt. Auch wenn man Werkzeuge herstellt, muss man den Anderen zu ihrem Gebrauch etwas erklären. Die Entwicklung der Sprache folgte also einer Art Evolutionsdruck.
Je komplizierter die Welt wird, desto komplexer wird also die Sprache?
Genau. Vor allem, wenn der Mensch damit beginnt, über andere Dinge als über das Jagen nachzudenken. Etwa darüber, wie seine Stellung in der Welt ist, oder ob es eine höhere Lenkungsmacht gibt. Heute sind es die Kinder, die diese Evolution der Sprache im Kleinen noch mal vorleben. Sie fangen bei Einwortsätzen an, und so ein Wort kann viel bedeuten. Mama kann heißen: „Hier bin ich“ oder auch: „Komm doch mal“. Oder: „Ich habe die Hosen voll.“
Es gibt über 6.000 Sprachen. Was ist überhaupt eine Sprache?
Es gibt verschiedene Kriterien, wonach man Sprachen voneinander und diese von Dialekten unterscheidet. Es geht um Unterschiede bei Lautsystem, Wortschatz und Grammatik. Wie etwa beim Deutschen und Chinesischen, die auch nicht historisch miteinander verwandt sind. Das Finnische ist ganz verschieden vom Schwedischen, weil diese Sprachen zu verschiedenen Sprachfamilien gehören. Bayerisch ist keine eigene Sprache, obwohl seine Sprecher dies gern behaupten. Das gemeinsame Band, das sämtliche Dialekte des Deutschen miteinander verbindet, ist die deutsche Schriftsprache, die alle lokalen Dialekte überdacht, und die eine Kommunikation über Dialektgrenzen hinweg gewährleistet. Ein wichtiges Kriterium ist das Fehlen einer gemeinsamen überdachenden Schriftsprache. So definieren sich z.B. die Sprachgrenzen zwischen Deutsch und Englisch oder zwischen Französisch und Italienisch.
Ist der Mensch nicht erst Mensch, wenn er redet?
Der Mensch ist Mensch, wenn er symbolische Tätigkeiten voll- zieht. Das kann auch die Verwendung von Zeichen sein. Man hat Knochen gefunden, auf denen der Homo erectus Ritzungen vorgenommen hat: Erst sieben, dann vierzehn, dann wieder sieben – also zusammengenommen eine Mondphase: eine kalen- darische Notation, die 300.000 Jahre alt ist. Sprache hat der Homo erectus nicht besessen, aber er hat visuell etwas formu- lieren können.
Inwieweit beeinflusst die Sprache die Welt, die wir wahr- nehmen?
Sehr stark. Wenn Sie in eine Kultur hineinwachsen, sind die Be- griffe oft schon in eine Richtung gelenkt. Als junger Mensch hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, sich auf einen Stein zu setzen und alles neu zu überdenken. Die Sprache bringt dem Individuum gleichsam eine Bewertung, wie die Gesellschaft die Welt sieht.
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, hat der Philosoph Ludwig Wittgenstein gesagt.
Das kann man so sagen. In jeder Sprache ist das Weltbild der Gesellschaft eingeprägt, in die man hineingeboren wurde und deren Kategorien man annimmt. Wenn ich eine andere Sprache lerne, bleibe ich daher in den meisten Fällen außen vor. Die Gren- zen bestehen aus Traditionen und Gewohnheiten. Wenn man mit Palästinensern und Israelis über grundsätzliche Fragen spricht, merkt man schnell, wie viele Vorurteile und Stereotype in die Sprache eingeflossen sind. Das wird von Generation zu Generati- on weitergegeben. Selbst wenn man miteinander spricht, spricht man über verschiedene Sachen.
Ist es nicht wichtiger denn je, miteinander zu reden, um die großen globalen Probleme zu lösen – wie zum Beispiel die Klimakatastrophe?
Richtig. Der Mensch muss es leisten, dass er über die Grenzen hinweg einen Konsens findet, um die Probleme zu lösen.
Benötigen wir also eine Weltsprache?
Bevor Sie die gesamte Weltbevölkerung auf ein neues Vokabular und die Regeln einstimmen, ist das Klima schon längst umgekippt.
Also müssen es doch Dolmetscher und Übersetzungsprogramme richten?
Leider gibt es keine Alternative. Die Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte Kunstsprache Esperanto hatte ja mal den Anspruch, die Länder einander näher zu bringen. Aber die meisten Men- schen können mit einer Sprache, die nicht auch Träger ihrer kulturellen Identität ist, nichts anfangen.
Aber Übersetzer allein scheinen nicht genug für die Verständigung tun zu können. Im Fall der EU kommt es einem so vor, als wären die vielen Sprachen ein Hemmnis auf dem Weg zu einer gemeinsamen Politik.
Es gibt über 20 Amtssprachen, die mit einem enormen Aufwand hin und her übersetzt werden. Da werden astronomische Sum- men verbraten. Aber wenn wir beginnen, die kleineren Sprachen in Brüssel auszusortieren, werden diese Länder am Einigungsprozess nicht mehr teilnehmen. Es ist wie immer mit der Demokratie. Churchill hat gesagt: Sie ist die schlechteste aller Regierungsfor- men, aber wir kennen keine bessere.
Verbirgt sich im Klang einer Sprache auch die Mentalität einer Gesellschaft? Das Deutsche klingt ja zum Beispiel für französische Ohren wenig romantisch.
Natürlich gibt es Themen, die eine Sprache prägen, aber noch viel mehr bestimmen soziale Schichten und Milieus die Sprache. Die Franzosen hatten über Jahrhunderte eine höfische Kultur gehabt – da ist ein gewisser Subtext vorprogrammiert. Deswegen ist es auch problematisch, Übersetzungsprogramme zu benutzen. Die helfen so viel, wie sie verzerren, weil man die kulturelle Ein- bettung, das Unterschwellige, nicht mitübersetzen kann.
So wie man im Persischen beispielsweise dreimal zum Essen eingeladen wird, bevor es ernst gemeint ist.
Genau.
Ich selbst habe drei Jahre lang in Japan gelebt, wo man nie Nein sagt. Die haben sogar einen Ausdruck dafür, wie man Dinge, die man nicht sagen will, umschreibt. Das ist so eine Art Umgehungssprache.
Ist Sprache auch ein Machtinstrument?
Aber sicher. Schon in einer Zeit ohne Staaten, aber mit politischer Macht in den Händen einer Gruppe. Als die Steppennomaden nach Warna kamen, haben sie den dortigen Bauern ihre Sprache aufgedrängt. Die hatten keine Wahl, als diese Sprache zu über- nehmen. Das war der erste Fall, in dem politische Macht Sprache gesteuert hat. Das haben die Römer später mit dem Latein per- fektioniert. Deswegen haben wir in Europa so viele romanische Sprachen.
Und warum spricht man in diesen Ländern nicht einheitlich Latein?
Das Latein war mal einheitlich und hat sich dann im Mittelalter in jedem Land differenziert, in einigen mehr, in anderen weniger. Ein Spanier kann nicht verstehen, was ein Franzose sagt. Aber Spanier und Italiener können sich noch verständigen, weil ihre Sprachen konservativer sind. Sie haben sich viel weniger verändert in den vergangenen Jahrhunderten. In Frankreich haben wir hin- gegen den ersten Fall in der Geschichte Europas, wo Sprache zur Ideologie wurde. Von oben, also vom König verordnet, entstand ein politischer Sprachnationalismus.
In Deutschland hat es so ein Bestreben nie gegeben?
Das Deutsche ist ursprünglich eine westgermanische Sprache, die dem Friesischen, dem Holländischen und Englischen nahe steht. Vor allem, wenn es um die Phonetik und die Grammatik geht. Die Wörter kommen von überall her – aus dem Lateinischen und Griechischen oder aus Arabien und nach dem Mittelalter sehr viele aus dem Französischen. Friedrich der Große sprach lieber Französisch als das ungehobelte Deutsch, und die Wissenschaftler blieben beim Latein.
„Er kann mich im Arsch lecken“, heißt es in Goethes „Götz von Berlichingen“. Haben die Schriftsteller dem Volk aufs Maul geschaut?
Schriftsteller wie Goethe oder Lessing haben im 18. Jahrhundert etliche deutsche Wörter geschaffen, die Lehnwörter aus anderen Sprachen ersetzten. So haben sie das Deutsche erneuert und ein Vokabular für das ganze Volk über Standesgrenzen hinweg geschaffen. Daran sieht man: Eine Sprache lebt in ihrer Zeit, es gibt keinen Stillstand. Eine Sprache, die sich nicht ändert, wird zum Fossil – wie das Lateinische. Die Römer hatten eine extrem puristische Sprachpolitik. Sie haben ständig Wörter ausgesiebt und keine Vulgarismen erlaubt.
Auch bei uns gibt es manchmal Sprachwärter. Beim Protest gegen die Rechtschreibreform waren sie laut zu vernehmen.
Die Rechtschreibreform war vor allem ein Lehrstück, wie Demo- kratie zu Stagnation werden kann – zur Unfähigkeit, etwas zu- stande zu bringen. Heute lässt jeder Verlag oder jede Zeitung anders schreiben. Wenn man so eine Reform machen will, kann man nicht so kurz springen und lauter Kompromisse machen.
Warum ist das Englische so dominant?
Da gibt es die griffige Formel eines anderen Sprachforschers: Wer hat als Erstes ein gut organisiertes Kolonialreich aufgebaut, und zwar global? Das waren Engländer. Von wo aus hat sich die Industrialisierung über die Welt verbreitet? Das waren die USA und England. Und wer hat den Krieg gewonnen und nach 1945 weltweit Einfluss genommen? Wieder die USA. Man kann sagen: Das Englische war immer zu rechten Zeit am rechten Platz.
Heute kommt es einem oft deplatziert vor: Die Menschen sitzen in „Meetings“, sie lassen sich „briefen“ und „debriefen“ oder reden über den „Mainstream“. Machen die vielen englischen Wörter das Deutsch kaputt?
Das ist die globale Marketingsprache. Sprachsoziologen sprechen vom Bloodless English – vom blutlosen Englisch. Man muss sich immer fragen, in welche gesellschaftlichen Bereiche das hinein- ragt. Wenn man sich die deutschen Bücher ansieht, dann sieht man da keinen großen Einbruch des Englischen. In technologischen Biotopen wie dem Internet ist das natürlich anders.
Sollten wir nicht eigene Wörter erfinden, wie die Franzosen das machen?
Die Realität ist doch, dass die Menschen dennoch alle Englisch sprechen, auch in Frankreich. Manchmal sind englische Wörter einfach griffiger, dann ist es auch gut, sie zu benutzen. Da war die deutsche Sprache immer offen. Das Problem ist eher, dass unsere Kommunikation sehr atemlos geworden ist und kaum Platz für die Pflege der Sprache lässt.
Weil ständig falsch geschriebene Kurznachrichten durch die Gegend schwirren ...
Man sollte gerade den jungen Leuten die Augen dafür öffnen, dass es sich lohnt, die eigene Sprache zu pflegen.
Wie sieht die Zukunft aus? Wird das Englisch noch gewinnen?
Ich kann mir vorstellen, dass das Chinesische dominanter wird. China ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht, und die dortigen Politiker werden vielleicht irgendwann kein Englisch mehr sprechen wollen. In Afrika, in dessen Wirtschaft China große Summen steckt, werden bereits viele Chinesischkurse angeboten. Da wächst also eine Generation von Afrikanern heran, die als Zweitsprache Chinesisch statt Englisch spricht.
Wäre es dann nicht sinnvoller, wenn die deutschen Schüler statt Latein Chinesisch lernten?
Heute vielleicht noch nicht, aber in 20 bis 30 Jahren sicherlich.
Sind im Zuge der Globalisierung Sprachen vom Aussterben bedroht?
Einige Forscher befürchten, dass bis zum Jahre 2100 rund 90 Prozent der derzeit über 6000 Sprachen aussterben werden. Ich sehe es nicht so apokalyptisch, gehe aber davon aus, dass fast die Hälfte verschwindet. Auch das ist alarmierend.
Was ist denn so schlimm daran? 3000 Sprachen müssten doch auch reichen.
Die Sprache ist ein Träger der Identität einer Gemeinschaft. In dem Moment, in dem die Menschen ihre Muttersprache aufgeben, werden sie passiv und nehmen nicht mehr engagiert am gesellschaftlichen Leben teil. Das können wir uns nicht leisten.
Die Jugend verhunzt die Sprache. Das ist auch so ein gängiges Vorurteil.
Die Klagen beziehen sich meistens auf dieses neue Pidgin- Deutsch – arg verkürzte Sätze, gespickt mit türkischen Lehnwörtern. Das Spannende ist, dass viele deutsche Jugendliche auf den Geschmack kommen und mit der Übernahme solcher Ausdrücke die Identität von Pidginsprechern annehmen, also von Zugewanderten. Man kann das aber auch positiv sehen und darin eine vitale Beschäftigung mit Sprache erkennen.
Benutzen nicht gerade junge Menschen die Sprache dazu, sich von den Eltern abzugrenzen?
Die sprachliche Abkapselung der jungen Leute ist eine Strategie ihrer altersbedingten Identitätsfindung. Sie wählen sich einen Sprachgebrauch, der ihnen das Gefühl der Solidarität und Gruppenzugehörigkeit vermittelt, gleichzeitig aber Grenzsignale nach außen setzt.
Zu diesen Strategien gehört eben auch die Verwendung von Denglisch. Sie sprechen lieber schlechtes Englisch als gutes Deutsch. Es wird ja auch immer schwerer, sich von den Eltern zu distanzieren, wenn die herumlaufen, als wären sie selbst noch 20. Da ist doch Sprache ein großartiges Mittel, unter sich zu bleiben.
Von Harald Haarmann ist im Verlag C.H. Beck unter anderem das Buch „Weltgeschichte der Sprache“ erschienen. Lesenswert zum Thema ist auch das Buch „Der Sprachverführer“ von Thomas Steinfeld, das in der bpb Schriftenreihe (Bd. 112) erschienen ist und für 4,50 Euro bestellt werden kann.