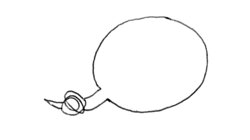Ostdeutsche bekommen in den Medien regelmäßig große Aufmerksamkeit. Werden in Frankfurt an der Oder Babys durch ihre Mutter ermordet und in Blumenkästen verscharrt, wird versucht, das mit dem Ostdeutschsein der Mutter zu erklären. Erhält die AfD in Mecklenburg-Vorpommern rund sechs Prozent mehr als in Baden-Württemberg, wird das durch das Ostdeutschsein der Wählenden erklärt. Prügeln sich Fans von Dynamo Dresden mal wieder durch einen Regionalzug, wird das durch das Ostdeutschsein der Fans erklärt. Diese Erklärungen funktionieren erstaunlicherweise schon seit mehr als 27 Jahren, seit dem Mauerfall. Es scheint, als diene der deutsche Osten seit 1990, als die DDR unterging, im Westen als Projektionsfläche für das „Andere“.
In der postkolonialen Theorie erklärt man solche Zuschreibungen durch das Konzept des „Othering“: Man definiert sich als Gruppe, indem man sich von anderen Gruppen abgrenzt. Die anderen Menschen dienen zur Beschreibung von all dem, was man selbst nicht ist. Das „Othering“ gab es in Bezug auf Ostdeutschland schon vor der Wiedervereinigung. Das Rechtssystem der DDR diente in Westdeutschland als Unrechtsbeispiel, um das eigene Rechtssystem als das erfolgreichere, bessere und gerechtere darstellen zu können.
Interessant ist auch, dass bei Kindsmörderinnen wie etwa zuletzt in Bayern eher die individuellen Gründe bei der Mutter gesucht werden. Ihr Westdeutschsein scheint hier keine Rolle zu spielen. Denn das ist nichts Besonderes, es weicht nicht von der Norm ab. Und die Norm ist westdeutsch, weiß, hetereosexuell und bürgerlich. Ostdeutsch ist anders.
Ein wichtiger Aspekt von Identität ist immer Differenz und weniger Gleichheit. „Wir wissen immer sehr genau, wer wir gerade nicht sind“, sagt der Soziologe Harald Welzer. Und so weiß man eben am besten, was deutsch ist, wenn man darüber nachdenkt, was es nicht ist. Und deswegen ist es sehr viel leichter zu sagen, was Ostdeutsche nicht sind, als was sie denn tatsächlich sind. Das meiste von dem oben Beschriebenen trifft nämlich auf die Mehrheit der Ostdeutschen nicht zu. Was bedeutet „Identität“? Noch spezifischer: Was bedeutet „ostdeutsche“ und „westdeutsche“ Identität? Wenn man darüber mit jungen Erwachsenen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren aus ost- und westdeutschen Großstädten diskutiert, kommt man der Funktionsweise des „Othering“ auf die Spur. Es wäre eigentlich vorstellbar, dass Ostdeutschsein nicht mehr mit der DDR verbunden wird, wenn man nicht selbst in diesem Staat gelebt hat. Aber das Verständnis von Ostdeutschland wird von den Eltern und deren Erfahrungen mit der DDR und der Wiedervereinigung geprägt. Vor allem die Abwertung der DDR-Lebensläufe und das Hinterfragen der politischen Einstellungen der Eltern wirkt auf die Kinder nach. Sie nehmen ihre Eltern als schwach wahr, wo sie sich eigentlich Orientierung erhoffen.
Zudem berichten die jungen Erwachsenen von Abwertungserfahrungen durch die öffentliche Darstellung von „Ostdeutschen“: Witze über Ossis, pauschale Verurteilungen als Kindermörderinnen, latent rechts wählend und mit einem Hang zum Hooliganismus. In diesen Momenten der Entwertung ihrer eigenen Herkunft nehmen sich selbst diejenigen, für die Ostdeutschsein sonst nur eine kleine oder gar keine Rolle spielt, als „Ostdeutsche“ wahr. Denn so wie die Ossis in einigen Medien dargestellt werden, so sind sie nicht, und sie solidarisieren sich mit der behaupteten sozialen Gruppe, die abgewertet wird.
Wir wissen vor allem viel besser, wer wir sind, wenn wir unsere Erfahrungen mit anderen vergleichen und die Unterschiede erkennen und wertschätzen. Wenn diese Unterschiede dann in der öffentlichen Diskussion Anerkennung finden, dann fällt es leichter zu sagen, wer wir sind, ohne damit gleich als nicht mehr dazugehörig wahrgenommen zu werden. Dazu müssen die Erfahrungen der vermeintlich „Anderen“ aber auch gehört werden. Die Kategorie „ostdeutsch“ wäre dann nur noch ein Teil eines großen Mosaiks, das wir Identität nennen können.