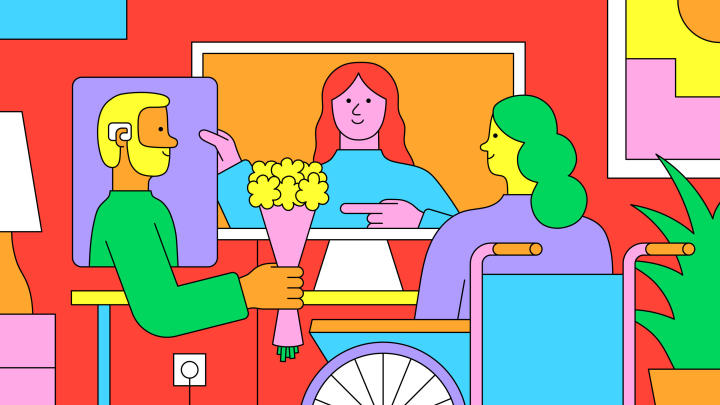Ich bin online, also wer bin ich
Lauren Oylers Roman „Fake Accounts“ erzählt von einer jungen Frau, die sehr viel Zeit im Internet verbringt. Nur nicht als sie selbst

Worum geht’s?
Eine namenlose Erzählerin sitzt in ihrem New Yorker Apartment, schnüffelt im Smartphone ihres Freundes herum und findet so heraus, dass der ein ziemlich bekannter Anhänger von Verschwörungserzählungen ist. Ein Schock für sie, nicht nur weil er behauptet hatte, gar keine sozialen Netzwerke zu nutzen, sondern vor allem weil sie dachte, er vertrete politisch in etwa dieselben vagen linken Ansichten wie sie. Noch bevor sie sich trennen kann (man erfährt nie, ob sie es wirklich getan hätte), erhält sie die Nachricht, ihr Freund sei bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Nach einer Woche, die sie apathisch auf Twitter verbringt, kündigt sie ihren Job als Autorin bei einem mittelanspruchsvollen Onlinemagazin und zieht planlos nach Berlin, in die Stadt, in der sie ihren (Ex-)Freund kennengelernt hat. Dort lernt sie zwar kein Deutsch, aber fängt an zu daten – mit Fake Accounts.
Worum geht’s wirklich?
Um die großen Identitätsfragen in Zeiten von Social Media: Gibt es noch einen Unterschied zwischen On- und Offline, wenn das Digitale das reale Leben vollständig durchdrungen hat? Und was für einen Einfluss haben die vielen Onlinepersönlichkeiten, die man sich zulegen kann, auf das Leben? Die Erzählerin selbst stellt sich diese Fragen nicht mehr, denn sie ist permanent online, sei es auf ihrem Twitter-Account (mit einer Followerzahl „im mittleren vierstelligen Bereich“) oder später in Berlin auf Datingseiten wie OkCupid, wo sie sich jeden Abend eine neue falsche Identität ausdenkt. Kein Moment, in dem man sich als Leser*in denkt: Ah, das ist jetzt also wirklich sie, jetzt ist sie authentisch. Das Authentische scheint eine Kategorie zu sein, die keinen Wert mehr hat. Am Ende fragt man sich, ob sie und ihr Freund überhaupt so verschiedene Leben hatten – oder nur verschiedene Formen der Täuschung lebten. Ganz nach dem Motto (das wahrscheinlich auch für viele andere Digital Natives gilt): Ich bin online, also bin ich.
Wie ist es erzählt?
Die Erzählerin ist sich ihres Status als Erzählerin sehr bewusst: Ab und an durchbricht sie die „vierte Wand“ und spricht ihre Leser*innen direkt an – ein Kniff, der den Text merklich auflockert und gerne öfter hätte passieren können. Außerdem gibt es eine Art Chor von (unsympathischen) Ex-Freunden, die Einspruch erheben, wenn ihnen die Entscheidungen der Erzählerin nicht gefallen. Abgesehen davon findet Oyler in „Fake Accounts“ einen sehr lakonischen Ton, der mit seinen schellen Pointen dem Stil von Tweets ähnelt, etwa wenn sie schreibt: „Ein Orgasmus kann durchaus etwas Ironisches haben, vor allem, wenn er dramatisch ist.“
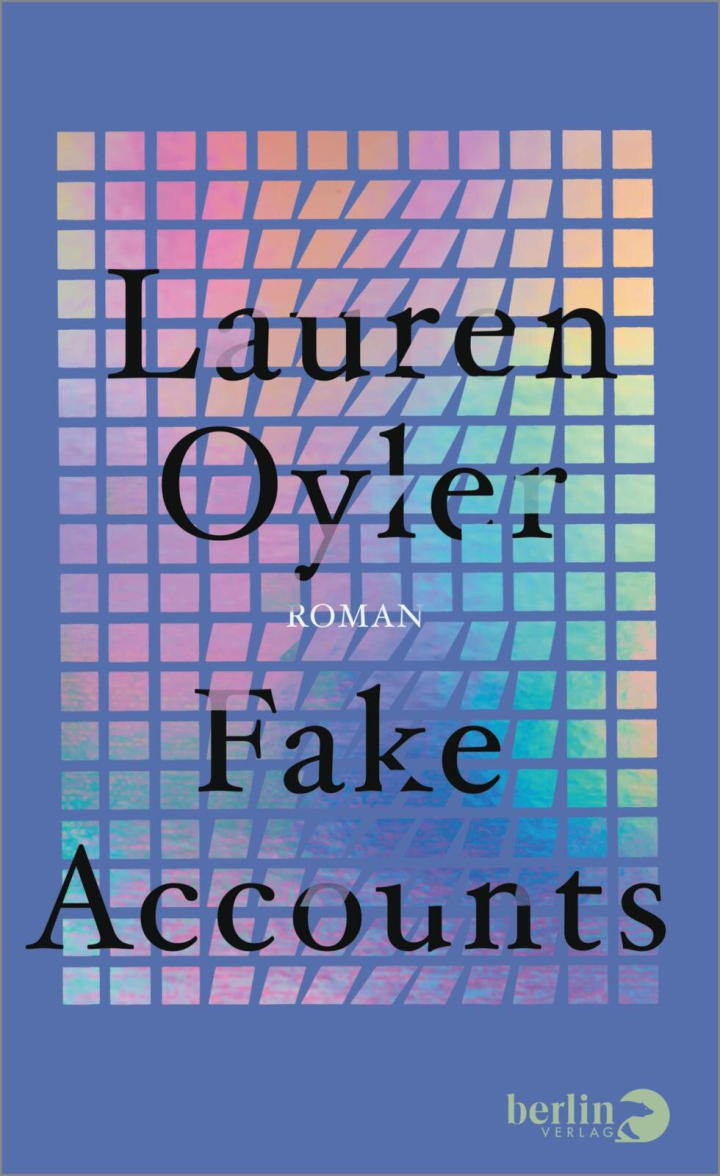
Lohnt sich das?
Ja, eigentlich schon. „Fake Accounts“ ist endlich mal ein Roman über das Internet, bei dem man als Leser*in nicht das Gefühl bekommt, der oder die Autor*in sei für das Buch zum ersten Mal im Leben auf TikTok gewesen. Und das Buch ist witzig, denn die Erzählerin drückt sich nicht davor, über ihr eigenes Leben oder das von anderen zu urteilen. Etwa wenn sie ihre Dates in schlechten Berliner Bars beschreibt, zum Beispiel mit einem französischen Projektmanager: „Geschäftsmäßig, in einem knackig frischen Hemd, für das ich mir extra Friedas Bügeleisen ausgeliehen hatte, fragte ich ihn über das Projektmanagement aus, als wüsste ich nicht, dass es kompletter Bullshit war.“ Oyler identifiziert außerdem Mechanismen des Digitalen, die problematisch sind, wie zum Beispiel die Verkürzung von Standpunkten auf ihr Erregungspotenzial – so weit, so kulturkritisch. Allerdings denkt man sich irgendwann: Es wäre auch interessant, mal eine Kulturkritik zu lesen, in der es den Figuren gelingt, einen Weg aus dem Spiegelkabinett der sozialen Medien heraus zu finden – sollte es denn einen geben.
Schade
Um zu den wirklich interessanten Beobachtungen vorzudringen, muss man schon einen langen Atem beweisen und sich durch viele Seiten apathischer Selbstbetrachtungen der Erzählerin quälen. Die polemische Kulturkritik ist Oyler definitiv besser gelungen als die literarische Handlung. Das ist nicht überraschend, denn Oyler wurde in US-amerikanischen Medien als (vernichtende) Literaturkritikerin bekannt.
Der beste Satz
… ist einer, den Lauren Oyler über Berlin schreibt: „Das Licht tauchte alles in einen unheimlichen Schieferton, egal zu welcher Tageszeit, als hätte es immer gerade geregnet oder als hätte man immer gerade geweint.“
Ideal für …
… alle Menschen, die es noch nicht geschafft haben, ihre Bildschirmzeit einzuschränken. Nach der Lektüre vergeht einem die Lust, sein Leben auf nie enden wollenden Newsfeeds zu verschwenden.
Titelbild: David Avazzadeh
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.