Kein Leben
Die Bürokratie macht es Asylbewerbern oft schwer, Arbeit zu finden. Auch deshalb fangen manche mit dem Drogenhandel an. Bericht aus ihrer perspektivlosen Welt
Sie stehen an der Ecke, dort, wo die Fußgängerzone endet. Ein Dutzend junge afrikanische Männer in weiten Jeans und Markenturnschuhen, die Kappen tief ins Gesicht gezogen. Sie stehen dort, um Drogen zu verkaufen. Jeder weiß das. In vielen deutschen Großstädten treiben sie sich seit einigen Jahren herum, im Hamburger Schanzenpark, in Berlin im Görlitzer Park, in Frankfurt im Bahnhofsviertel oder hier, in der armen Dortmunder Nordstadt.
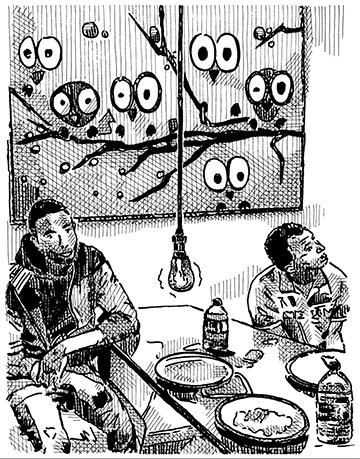
Zwei der Afrikaner radeln abwechselnd auf rostigen Uralträdern umher, in Zeitlupe, die Reifen fast platt. Vorbei an arabischen Cafés und Läden, in denen grell leuchtende Mekka-Bilder verkauft werden. Sehen sie jemanden, der wie ein Kiffer aussieht, dann schnalzen, knacken oder zischen sie und raunen: „Alles klar, brauchst du was? Bruda, kein Problem.“ Mehr als 30.000 Westafrikaner leben in Nordrhein-Westfalen. Viele haben keine Chance auf Asyl, werden geduldet, oft führen nur Schwangerschaften oder eine Heirat in den legalen Aufenthalt. Amadou Diallo, das ist nicht sein richtiger Name, trägt einen modischen Kinnbart, seine Sneaker in Samtoptik haben goldene Streifen. Wenn Amadou eine Frage stellt, dann bohrt er, um sie zu unterstreichen, seinem Gegenüber manchmal mit dem Finger in die Brust. Oury B., der auch nicht so heißt, trägt eine Bomberjacke in Flecktarn, kurze Rasta-Noppen stehen ihm vom Kopf.
Er wäre lieber Krankenpfleger als ein Dealer hier an der Ecke, aber die Ausländerbehörde lässt ihn nicht. Das jahrelange Hickhack mit den Behörden habe ihn zermürbt. Er mache gerade eine Psychotherapie, sagt er.
Amadou Diallo kocht. Auf dem Herd blubbert Niri – Reis und Rind in Tomatensauce. Die Wohnung in einem dieser heruntergekommenen Häuser in der Nordstadt hat ihm ein Afrikaner untervermietet. Es gibt kaum Möbel, von den Decken baumeln nackte Glühbirnen, in der Küche stehen zwei alte Sofas mit Brandflecken, davor ein wackliger Plastiktisch.
Das jahrelange Hickhack mit den Behörden habe ihn zermürbt. Er mache gerade eine Psychotherapie, sagt er.
2013 stellte er im Kreis Steinfurt im Norden Nordrhein-Westfalens seinen Asylantrag: als Amadou Diallo, geflohen aus Guinea, weil er und seine Familie verfolgt würden. Tatsächlich hat er einen ganz anderen Vornamen und war Handyverkäufer in Guineas Hauptstadt Conakry. Amadou Diallo ist ein Allerweltsname, das westafrikanische Pendant zu Thomas Müller. Er hätte gern gearbeitet, durfte aber nicht. Zwei Jahre brauchte die deutsche Bürokratie, um seine Identität zu klären, bis dahin sollte er als Geduldeter in einem Wohnheim herumsitzen, mit einem Arbeitsverbot belegt. Tatsächlich stand er schon nach wenigen Wochen in der Dortmunder Nordstadt und vertickte Drogen. Bis ihm im August 2015 die Ausländerbehörde mitteilte, dass seine Duldung nicht verlängert werde und er binnen 30 Tagen Deutschland verlassen müsse. Daraufhin tauchte er unter.
Bouba* hat es geschafft. Vor sechs Jahren kam er aus Westafrika nach Dortmund und durfte bleiben, weil er, noch während sein Asylantrag lief, eine junge deutsche Studentin heiratete. Bouba ist smart, er hat einen offenen, wachen Blick und trägt ein gebügeltes Hemd, keine dicken Ketten aus Falschgold. Inzwischen wohnt er in einer Nachbarstadt und studiert dort auf einen Ingenieursabschluss hin. Aber manchmal zieht es ihn zurück in Dortmunds Norden, dahin, wo auch für ihn alles anfing. Dann steht er mit den Drogenhändlern an der Ecke und kauft sich ein paar Gramm Gras, für abends, wenn er nicht lernen muss. Er kennt die Dealer. Aber er hat kaum Verständnis für sie. „Sie machen auf Mitleid und lügen“, sagt er. Sicher, einige strengten sich an, versuchten sich zu integrieren, zerbrächen dann aber an der Perspektivlosigkeit. Doch die meisten fänden sich viel zu schnell ab mit ihrer Lage. Resignierten viel zu früh. Und wollten dann nur noch mitnehmen, was geht. „Die tun alles für Geld.“
Alle haben Angst. Angst vor den Flüchtlingen, vor anderen Migranten, den besoffenen Deutschen.
Wie die anderen Afrikaner verkauft Amadou Marihuana, das Fünf-Gramm-Tütchen zu 50 Euro. Wenn seine Drogenvorräte erschöpft sind, holen er und die anderen sich manchmal Nachschub bei den Arabern, die ein paar Meter weiter vor den Cafés stehen und rauchen. Er hasst die Araber, aber sie geben in der Nordstadt den Ton an – einem Viertel, das die „FAZ“ mal „Getto mitten in Deutschland“ nannte und dessen Drogenszene kürzlich Stoff für einen „Tatort“ war. Jeder Vierte der gut 50.000 Einwohner hier hat keinen Job, mehr als zwei Drittel haben ausländische Wurzeln, fast jeder Zweite besitzt keinen deutschen Pass. Egal, wen man fragt, Taxifahrer, Kioskbesitzer, Friseure, Passanten: Alle haben Angst. Angst vor den Flüchtlingen, vor anderen Migranten, den besoffenen Deutschen.
Die Araber aus dem Maghreb schauen auf die Dunkelhäutigen herab, ein Rassismus, der Afrika durchzieht und sich in der Nordstadt spiegelt. „Die Nigger sehen keine Frauen auf der Straße, sondern nur Aufenthaltspapiere“, schimpft der Anführer der algerischen Dealer im Keuning-Park, ein Hüne im Jogginganzug. „Muss nur eine dick werden, paff, können die bleiben.“
Und mittendrin die jungen Linken vom Kulturverein „Nordpol“, die in Amadou und den anderen Flüchtlingen nur Ausgebeutete sehen – Studenten und Sozialarbeiter Anfang 20, mit schwarzen Schals und schwarzen Hosen, deren Taschen Platz für Drehtabak und Aufkleber lassen. Sie betreiben im Nordpol ein „Refugee Welcome Café“, veranstalten manchmal Sprachkurse und diskutieren über das „systemische Problem Polizei“. Manche halten sie für radikal – die Afrikaner sind ihnen dankbar. Für sie sind es die einzigen Menschen, die ihnen helfen.
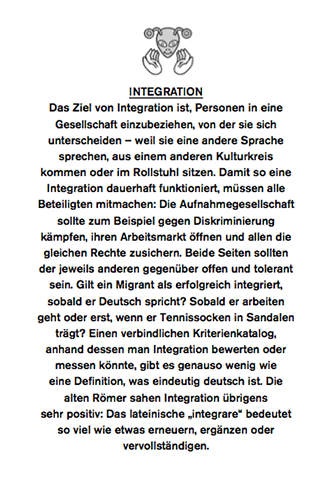
Als Emmanuel Peterson zu seiner Mutter und seinen beiden Schwestern, die schon vor ihm hier wohnten, aus Ghana nach Deutschland kam, war er zehn. Seine Mutter wurde als Asylbewerberin anerkannt, er träumte davon, Profifußballer zu werden, schaffte es tatsächlich bis in die dritte Liga, aber dort war dann Schluss. Später hat er den „Verein junger Deutsch-afrikaner“ gegründet, der bei Behördengängen hilft, Konflikte löst, beitragen will zur Integration. Peterson, 29, ist ein Athlet mit breiten Schultern und einem ansteckenden Lachen. Jeder Dönerverkäufer in der Nordstadt freut sich, wenn er ihn sieht, und grüßt ihn mit Handschlag. Peterson hat einen nüchternen Blick auf die jungen Afrikaner. „Sie wissen, dass sie in Deutschland nur bleiben können, wenn sie lügen“, sagt er, während er durchs Viertel schlendert.
„Deswegen schmeißen sie ihren Pass weg, machen sich jünger oder ändern ihren Namen.“
Der Aufenthaltsstatus vieler Westafrikaner heißt „geduldet“. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt, aber sie werden nicht abgeschoben, weil noch Pässe fehlen, es in ihrem Heimatland zu gefährlich oder ihre Identität nicht geklärt ist. Eine Duldung ist das Niemandsland der Einwanderung. Eine Arbeitserlaubnis zu bekommen ist sehr schwierig. 2014 wurde die Wartezeit jedoch auf drei Monate und die Vorrangprüfung auf 15 Monate verkürzt. Theoretisch dürfen sie also arbeiten. Allerdings nur, wenn sie ihre Mitwirkungspflichten zur Ausreise (z. B. die Vorlage von Dokumenten) nicht verletzt haben – und die Ausländerbehörde grünes Licht gibt. Aber warum sollte sie das? Sie will ja abschieben und wartet nur darauf, dass die Identität geklärt wird und Pässe vorliegen.
Emmanuel Peterson sagt: „Es ist der Mangel an Alternativen, der die Jungs auf die Straße treibt.“ Sie kämen nach Europa, um zu arbeiten, wollten ranklotzen, etwas aufbauen. Aber dann dürften sie nicht. Es gebe nur zwei Möglichkeiten: Entweder man gebe den jungen Afrikanern eine Chance. Oder man gebe ihnen ein Rückflugticket. Aber dieses Dazwischen? Peterson schüttelt den Kopf.
Vor Frank Binder haben die jungen Guineer Angst. Er ist Flüchtlingsreferent der Ausländerbehörde Dortmund und hat früher dafür gesorgt, dass etliche von ihnen abgeschoben wurden. Er reiste schon nach Guinea, um Pässe zu besorgen.
„Die Nordstadt ist ein vielseitiges und schönes, aber auch ein Multi-Problem-Viertel“, sagt der Sprecher der Dortmunder Polizei diplomatisch.
Binder sitzt in offener Jacke am Schreibtisch in seinem gänzlich leeren Büro, schwarzes, volles Haar, zum Vokuhila geschnitten, aber so seriös und sachlich, dass er im Grundbuchamt sitzen könnte. Bis vor drei Jahren sollten alle geduldeten Westafrikaner abgeschoben werden, sobald sie auf dem Papier volljährig waren, woraufhin etliche offenbar abtauchten. Dann änderte Dortmund seine Strategie, und nun erklärt Binder, alle der rund 400 in Dortmund hätten eine „gute Bleibeperspektive“. In den vergangenen drei Jahren habe man keine Guineer aus Dortmund abgeschoben. „Jeder guineische Flüchtling, der sich an die Spielregeln hält und mit offenen Karten spielt, kann bleiben.“ Heißt: wenn er nicht straffällig wird und seinen echten Pass abgibt. Der Pass sei das Wichtigste. Nur dann könne er, Binder, helfen, ihnen eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Binder stellt klar: „Wenn man zu oft beim Dealen erwischt wird, dann hat man jedes Aufenthaltsrecht verwirkt.“
„Die Nordstadt ist ein vielseitiges und schönes, aber auch ein Multi-Problem-Viertel“, sagt der Sprecher der Dortmunder Polizei diplomatisch. Die Guineer seien ein Mosaiksteinchen unter vielen. Es gebe dort Straßenkriminalität, eine Alkoholiker- und eine Drogenszene. 300-mal wurden Algerier und Marokkaner wegen Raub und Diebstahl angezeigt, die Guineer fielen eben durch das Dealen auf. Er widerspricht der Behauptung, dass die Polizei die Lage nicht im Griff hat. Die Kriminalität in der Nordstadt, das Dealen der Afrikaner an den Ecken sei Ausdruck eines „gesellschaftlichen Problems“ und durch Polizeiarbeit allein nicht zu lösen.
Auch Oury kam mit falschem Pass über Frankreich nach Deutschland, auch er behauptete, minderjährig zu sein, man kann ihn aber auch auf knapp 30 schätzen. Sein Asylverfahren läuft noch, zur Sicherheit hat er seinen Pass weggeworfen, damit er nicht so leicht abgeschoben werden kann, sollte es abgelehnt werden. Seit zwei Jahren dealt er in der Nordstadt, dreimal hat ihn die Polizei in dieser Zeit mit Gras erwischt. Einmal bekam er 90 Sozialstunden in einem Jugendheim aufgebrummt. „Das war toll“, strahlt Oury, wenn er davon erzählt, „ich wollte da mit den Leuten gerne bleiben.“ Er bekam einen Ausbildungsvertrag angeboten und stellte bei der Ausländerbehörde im Kreis Gütersloh einen Antrag, die Stelle antreten zu dürfen. Die Beamten hätten abgelehnt, erzählt Oury.
„Keine Arbeit. Keine Zukunft. Nicht zurück“, sagt Oury, auf seinem ungemachten Bett kauernd.
Zurück nach Afrika? Geht auch nicht. Jeder daheim wüsste, welcher Sohn von welcher Familie in Deutschland ist. Die Menschen in den Dörfern erwarteten Großzügigkeiten, die Familien Geld. Dass es ihnen schlecht geht, glaube in Guinea keiner. „Keine Arbeit. Keine Zukunft. Nicht zurück“, sagt Oury, auf seinem ungemachten Bett kauernd. Und eine Freundin habe er auch nicht. „Warum soll ich eine Freundin haben mit meinem Scheißleben?“
Aladin El-Mafaalani ist Professor an der FH Münster und forscht zu minderjährigen Flüchtlingen. „Die Afrikaner haben gelernt, dass die deutsche Bürokratie langsamer ist als sie“, sagt er. „Sie unterwandern das System und tauschen ihren Pass und ihre Identität gegen einen Aufenthalt ein. Gleichzeitig verbauen sie sich dadurch alle Chancen auf ein legales Leben.“
Im Grunde genommen lässt Deutschland nur zwei Gruppen herein: Hochqualifizierte und Verfolgte. Inder mit einem Abschluss in Informatik oder Syrer, die vor Fassbomben fliehen. Doch dazwischen gibt es unzählige andere, die auch kommen wollen. Die nach einem Schlupfloch suchen. Der neuen Migration und dem Erfindungsreichtum der Wandernden ist dieses System nicht gewachsen. Es fehlen Perspektiven, legal einwandern zu können, und zugleich ein Plan, der dafür sorgt, dass sich im Land kein illegales Subproletariat bildet.
El-Mafaalani erzählt von den Libanesen, die in den 1980er-Jahren in die USA geflohen sind, dort für sich sorgen mussten – und heute bestens integriert sind. Während ihre nach Deutschland geflüchteten Landsleute jahrelang geduldet wurden, ohne Recht auf Arbeit, nicht einmal ihre Kinder durften zur Schule gehen. „Ich wundere mich“, sagt El-Mafaalani, „dass die Kriminalität unter den Libanesen in Deutschland nicht noch höher ist.“
Nach dem Essen serviert Amadou eine afrikanische Brause, Ingwerbier und frischen Minztee. Dann zeigen er und seine drei Freunde Videos auf ihren Handys von prügelnden Soldaten in Guinea. Sie erzählen von der Willkür und den Unruhen, die zugenommen haben, seit im Oktober Staatspräsident Alpha Condé die Wahl gewann. Amadou zieht ein afrikanisches Gewand über sein Guinea-Fußballtrikot, dann knien sich alle vier auf den Wohnzimmerteppich und beten.
*Name geändert
Unser Autor ist Mitarbeiter des Non-Profit-Recherchezentrums Correctiv.org, das sich investigativen Reportagen widmet und über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert.