In bester Verfassung
Viel Applaus bekam der Parlamentarische Rat nicht, als er das Grundgesetz entwarf. Dabei schuf er – ohne es zu wollen – viel mehr als nur ein Provisorium
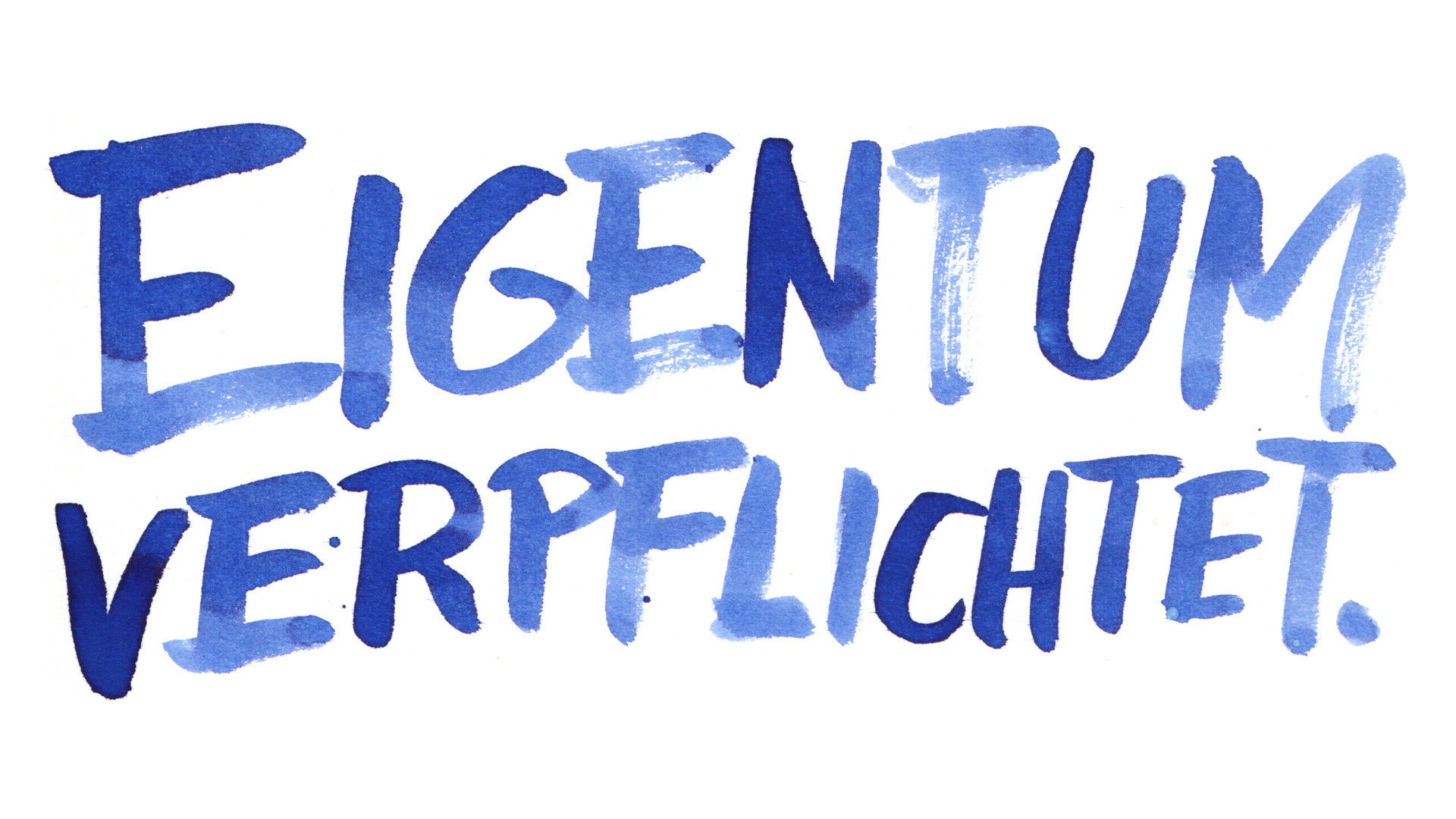
Auch wenn es etwas Großes zu feiern gab, ein großes Fest fand am 23.5.1949 nicht statt. Kein Umzug, kein Feuerwerk, kein Bankett und auch keine euphorische Menschenmenge auf den Straßen begleitete die Unterzeichnung des Grundgesetzes in Bonn. Am Ende der Schlusssitzung des Parlamentarischen Rats sangen Abgeordnete und geladene Gäste gemeinsam das patriotische Studentenlied „Ich hab mich ergeben“. Als um 24 Uhr das Grundgesetz in Kraft trat und damit die Bundesrepublik Deutschland ihre Geburtsstunde hatte, waren in Bonn längst die Lichter aus. Ein stiller Start in eine neue Zeit.
Die Menschen im besetzten Deutschland quälten eben andere Sorgen. Sie litten immer noch unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs. Allein rund zwölf Millionen Flüchtlinge und Vertriebene suchten eine neue Heimat, dazu kamen die Kriegsgefangenen, die in die ausgebombten Städte zurückkehrten. Ein dramatischer Mangel an Wohnungen und Lebensmitteln überschattete das tägliche Leben, die Wirtschaft kam nur stotternd in Gang. Gleichzeitig bewegte die drohende deutsche Teilung die Gemüter. Die Sowjetunion war im März 1948 aus dem Alliierten Kontrollrat ausgeschieden und hatte im Juni um Berlin eine Blockade verhängt. Nur noch per Flugzeug konnten die Westsektoren der Stadt versorgt werden.

Großbritannien, Frankreich und die USA forderten ihrerseits die Ministerpräsidenten der drei westdeutschen Besatzungszonen auf, eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen, die „eine Regierungsform des föderalistischen Typs“ entwerfen sollte. Am 1.9.1948 tagte der Parlamentarische Rat erstmals in Bonn. Die 65 Delegierten waren weit davon entfernt, die Gesellschaft zu repräsentieren, für die sie handelten. Das Durchschnittsalter lag bei 56 Jahren, nur vier Frauen gab es, zwei Drittel waren Akademiker, es überwogen Juristen, und mehr als die Hälfte hatte einen Doktortitel. Elf Abgeordnete hatten bereits in der Weimarer Republik im Reichstag gesessen und drei von ihnen sogar an der Verfassung von 1919 mitgeschrieben.
Die große historische Hypothek – das Scheitern der Weimarer Republik und die Gräuel der Nazidiktatur – lastete schwer auf den Verhandlungen, die nur mühsam vorangingen. Immer wieder kam es zu parteipolitischen Streitereien und Auseinandersetzungen mit den Alliierten. Theodor Heuss, später der erste Bundespräsident, ging davon aus, dass die Arbeit vielleicht zwei Monate dauern würde. Anfang November wollte er wieder an der Universität Freiburg unterrichten. Letztlich musste er fast neun Monate in Bonn bleiben, bis der Entwurf in der dritten Lesung am 8.5.1949 mit 53 zu zwölf Stimmen angenommen wurde und zur Ratifizierung an die Landtage gegeben werden konnte.
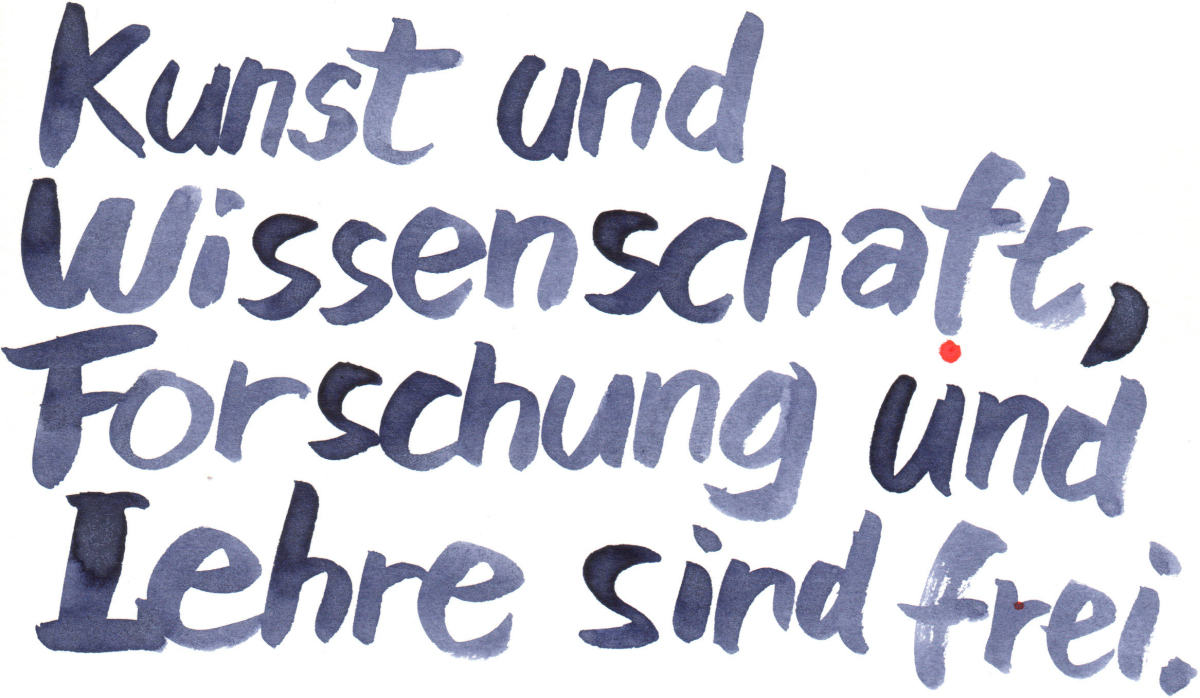
Um aus dem langen Schatten von Weimar herauszutreten, korrigierte der Parlamentarische Rat konsequent die Schwächen der Verfassung von 1919. So entwarf er das Modell eines föderalistischen Staats mit dezentraler Machtverteilung, in dem die Bundesländer ein starkes Gegengewicht zur Zentralgewalt darstellten. Mit dem Bundesrat wurde ein weiteres Organ eingerichtet, durch das sie ihre Interessen wahren konnten. Gleichzeitig wurde die präsidiale Macht des Staatsoberhaupts stark eingedämmt, die zu Weimarer Zeiten eine Art Ersatzkaiser war, und Volksentscheide auf Bundesebene abgeschafft. Die Schlüsselfigur wurde der Bundeskanzler, dessen Entscheidungsgewalt durch ein konstruktives Misstrauensvotum beschränkt werden konnte. Als juristische Infrastruktur wurde das Bundesverfassungsgericht eingerichtet, das über das Grundgesetz wachte und einen politischen Streit letztinstanzlich und unanfechtbar beenden konnte.
Viel Applaus wurde den Gründungsvätern und -müttern des Grundgesetzes nicht zuteil, von einer Verehrung, wie sie die Founding Fathers in den USA erfuhren, ganz zu schweigen. Erst mal waren alle unzufrieden. Die Kirchen beklagten sich über zu wenige christliche Werte, die Gewerkschaften sahen maßgebliche arbeitsrechtliche Forderungen außen vor, die CSU lehnte den Entwurf im Landtag ab, weil sie die Hoheitsrechte der Länder nicht ausreichend gewürdigt sah, die KPD wiederum weigerte sich, die „Spaltung Deutschlands“ zu unterschreiben, und der Literat Kurt Hiller spottete in der „Zeit“ über das „Bürosaure und Muffige“ des „zusammengeschwitzten Opus“. Beispielsweise ärgerte ihn die unsaubere Formulierung des Artikel 4, Abs. 3 („Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden“): „Mit dem Besen, dem nassen Lappen, der nackten Faust, dem erigierten Zeigefinger oder dem rollenden Auge darf also offenbar jeder zum Kriegsdienst gezwungen werden! Nur mit der Waffe nicht.“

Vielleicht war es auch der immer wieder vom Parlamentarischen Rat betonte Charakter des Provisoriums, der die Begeisterung für das Grundgesetz zunächst dämpfte. Diese Idee des Provisoriums ist einmalig: Das Grundgesetz ist die weltweit einzige demokratische Verfassung, die unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit stand. Die Präambel erinnerte und mahnte, „die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden“. Bis dahin sollte das Grundgesetz eine Ordnung geben, es sollte einer Einigung nicht im Wege stehen. Die Präambel konnte man aber durchaus als Entwertung des Gesetzestextes verstehen.
Das Provisorium erwies sich indes als äußerst langlebig. Es überdauerte die turbulenten Nachkriegsjahre, den Kalten Krieg und die deutsche Teilung. Es sicherte Wohlstand und Frieden und sorgte damit für eine große Akzeptanz Deutschlands in der Völkergemeinschaft. Als die DDR, die ihre Staatsgründung im Oktober 1949 mit Fackelumzügen, Betriebsbesuchen der SED-Spitze und großen Kundgebungen als Zeitenwende inszenierte, schließlich 1989 kraftlos in sich zusammenbrach, wurde das Grundgesetz nach der Wiedervereinigung de facto zum „Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk“ erhoben. Immerhin erlebte das noch der fränkische Sozialdemokrat Hannsheinz Bauer, als Einziger aus dem Parlamentarischen Rat, der das Grundgesetz 1949 unterzeichnet hatte.
Dieser Text ist im Fluter-Heft Demokratie erschienen.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.