Neue Ideen für die Demokratie
Das Parlament per Los zusammensetzen, nur politisch Gebildete wählen lassen, digitale Bürgerbeteiligung – es gibt Ideen, um die Demokratie zu erneuern. Wir stellen vier vor
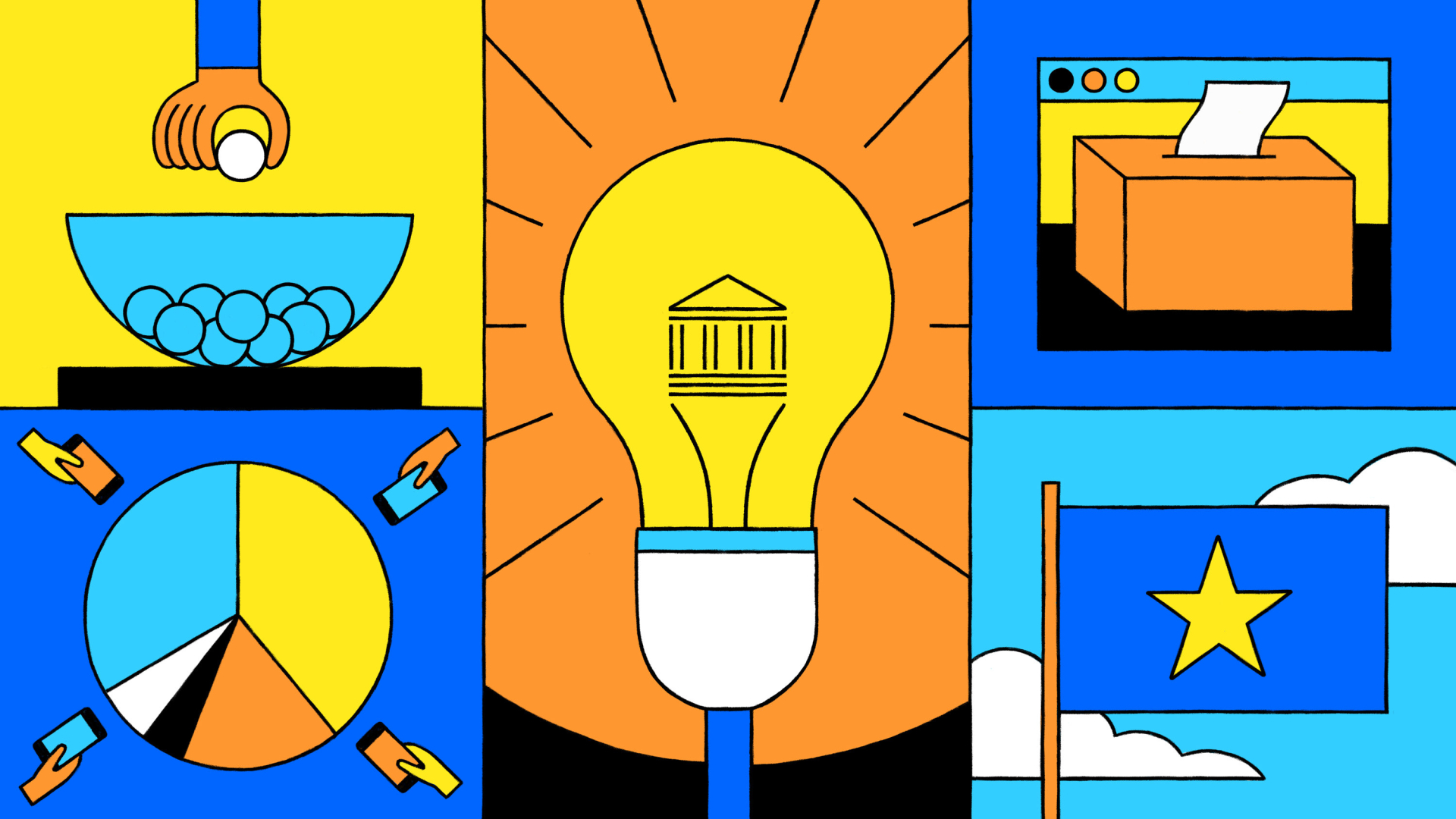
Viele sahen diese Staats- und Regierungsform schon auf einem weltweiten Siegeszug. Doch in Zeiten wachsender Uneinigkeit über Themen wie Klimawandel, ökonomische Ungleichheit und Migration gewinnen manche den Eindruck, demokratische Staaten seien ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen. Umfragen zeigen, dass das Vertrauen in Politik und die Legitimität demokratischer Entscheidungen zurückgeht – ebenso die Wahlbeteiligung.
Eine Reihe von politischen Denkern, Wissenschaftlern und Aktivisten ist der Überzeugung, dass die Demokratie im 21. Jahrhundert neu gedacht werden muss. Grundsätzlich lassen sich ihre Vorschläge in zwei Kategorien einteilen:
Die einen argumentieren, dass etwa die Mehrheitsentscheidung der Briten, die EU zu verlassen, und die Wahl Donald Trumps auf die Ignoranz der Wähler zurückzuführen sind. Daher sei die Lösung: weniger Mitbestimmung. Ein viel diskutiertes Beispiel für eine solche Forderung ist die Idee der Epistokratie, die aktuell von dem Philosophen Jason Brennan vorgestellt wird. Brennan fordert, dass es nur Wählern mit einem Mindestmaß an politischer Bildung erlaubt sein soll, an demokratischen Beteiligungsprozessen teilzunehmen. Nur so würden die objektiv „besten“ Entscheidungen getroffen und infolgedessen auch die Politik ihre Legitimität zurückgewinnen.
„Wir brauchen ein Systemupdate für die Demokratie“
Ganz anders stehen das einige Wissenschaftler, die den Vertrauensverlust genau umgekehrt begründen: nämlich mit mangelnder Beteiligung. Die führen sie darauf zurück, dass die klassischen Instrumente wie Wahlen, Repräsentation und Parteimitgliedschaften nicht mehr ausreichend seien – und fordern daher neue Formate demokratischer Mitbestimmung. Sophie Pornschlegel vom Progressiven Zentrum etwa fordert deshalb ein „Systemupdate“ der Demokratie. Es müssten ergänzende Instrumente und Denkmuster entwickelt werden, die „die Werte der Demokratie stärken und den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen sind: der Digitalisierung, der Migration, einer globalisierten Welt“.
Wir stellen euch hier vier verschiedene demokratische Innovationen vor, die nach Auffassung ihrer Initiatoren dazu beitragen könnten, die Demokratie in turbulenten Zeiten zu stärken.
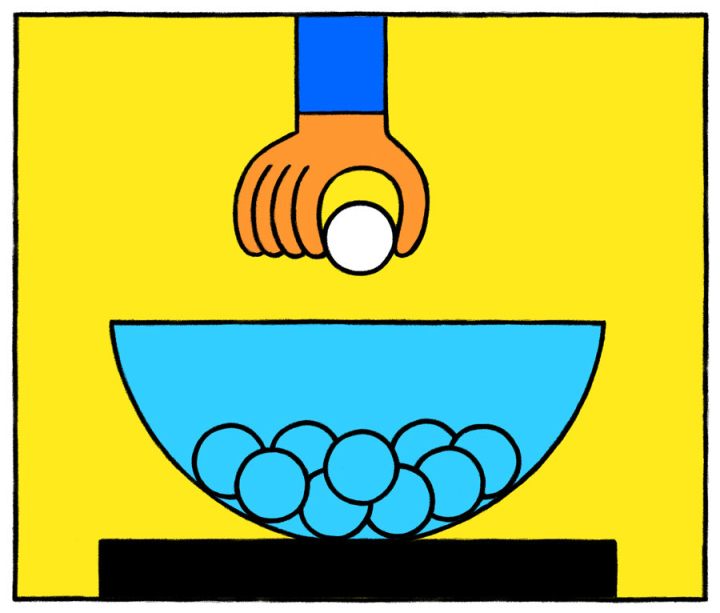
Das Los entscheidet, wer regiert
Ziemlich provokant klingt der Vorschlag des Historikers David Van Reybrouck, Wahlen als Auswahlprozess für politische Repräsentanten größtenteils durch ein Losverfahren zu ersetzen. Das Ergebnis könnten Parlamente sein, die zur einen Hälfte aus gewählten fachkundigen Politikern und zur anderen aus zufällig ausgelosten Bürgern bestehen. Befürworter argumentieren, dass so eine Fokussierung auf Wahlkämpfe durchbrochen werden könne. Wahlen und parteipolitisches Engagement seien außerdem nicht das fairste Mittel, um politische Repräsentanten zu bestimmen. Denn durch die Arbeit oder Kindererziehung komme mancher kaum dazu, sich umfassend zu informieren oder einzubringen. Außerdem, so die Argumentation, verlangten viele Parteien, dass die Kandidaten einen Teil der Wahlkampfkosten selbst übernehmen. Das führe dazu, dass in den Parlamenten nicht alle Teile der Bevölkerung gleich repräsentiert seien.
Auch nach Ansicht der Politikwissenschaftler Claus Leggewie und Patrizia Nanz braucht Politik eine größere Perspektivenvielfalt – um das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen und bessere Entscheidungen zu treffen. Auch die Erfahrungen von Alleinerziehenden, ALG-II-Empfängern und Menschen mit Migrationshintergrund müssten einbezogen werden.
Van Reybrouck kann einige erfolgreiche Beispiele für Bürgerbeteiligung per Los anführen. Als etwa nach der belgischen Wahl 2010 lange keine Regierung zustande kam, berief eine Bürgerinitiative, an der Van Reybrouck selbst beteiligt war, auf diese Weise einen Bürgerkongress ein. Flamen und Wallonen aus den beiden zerstrittenen Landesteilen diskutierten dort über die drei wichtigsten Themen, die durch eine Online-Abstimmung ermittelt worden waren. In ähnlichen Formaten sind in Kanada, den Niederlanden, Island und Irland bereits wichtige politische Entscheidungen herbeigeführt worden.
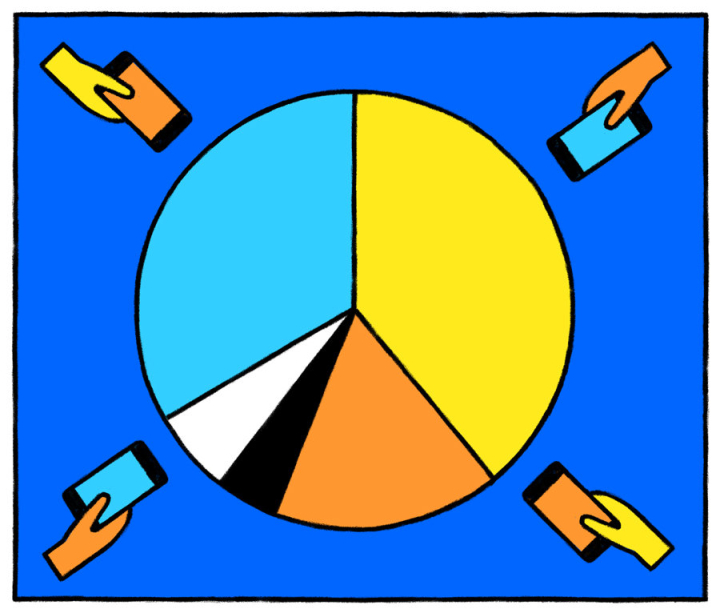
Die Bürger entscheiden übers Geld
Eine häufige Kritik an bestehenden Formen der demokratischen Entscheidungsfindung ist auch, dass durch sie Geld ausgegeben werde für Maßnahmen, die den Bürgern gar nicht wirklich wichtig sind. Umfragen zufolge wünschen sie sich mehr Geld in den Bereichen Bildung, Familie oder digitale Infrastruktur – bisher wird in diese nur ein verhältnismäßig geringer Anteil öffentlicher Gelder investiert. Deshalb gibt es die Forderung nach Bürgerhaushalten: Bürger sollen selbst und direkt entscheiden, wohin Geld fließt. Das, so die Argumentation der Befürworter, würde die Transparenz bei der Vergabe von Steuergeldern radikal erhöhen, und die Betroffenen selbst könnten Prioritäten setzen. Gerade für ökonomisch und sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen, die in höherem Maße auf staatliche Zuwendungen angewiesen sind, würde das die politische Teilhabe deutlich erhöhen.
Die Idee des Bürgerhaushalts wurde 1989 von der brasilianischen Arbeiterpartei für die Kommunalpolitik Porto Alegres entwickelt – als Maßnahme gegen Korruption. In der brasilianischen Stadt konnten so Hunderte Projekte durchgeführt werden, die der Verbesserung der Bildung und der gesundheitlichen Versorgung dienen. Seit der Einführung der Bürgerhaushalte gibt die Stadt mehr Geld für die Allgemeinheit aus, in der Verwaltung wiederum wird immer mehr Geld eingespart. Es wird geschätzt, dass 2014 weltweit bis zu 2.700 Kommunen unterschiedliche Formen des Bürgerhaushalts verwendeten.
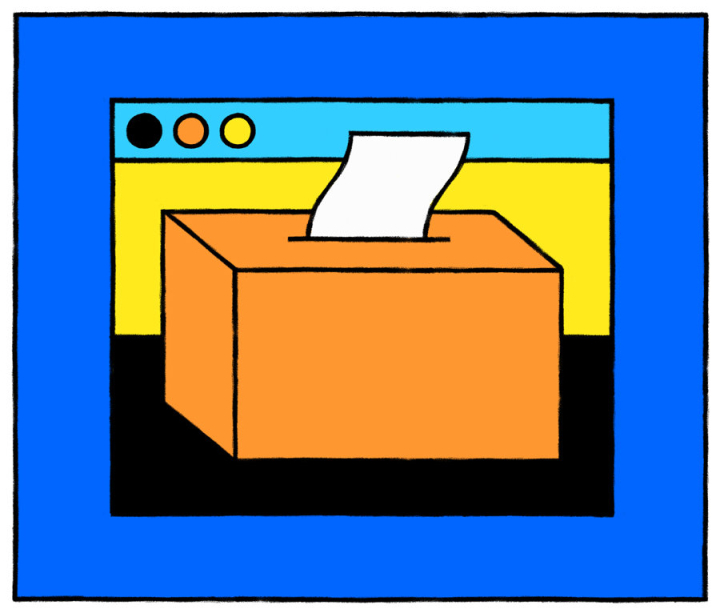
Digitale Demokratie
Ein viel diskutierter Vorschlag ist das Modell Liquid Democracy, das die klassische Form demokratischer Repräsentation radikal infrage stellt. Anstatt bis zur nächsten Wahl die Entscheidungen über Gesetze an Parteiabgeordnete zu übergeben, sieht es eine „Verflüssigung“ demokratischer Repräsentation vor: Bei jeder Abstimmung entscheiden die Bürger erneut, ob sie selbst abstimmen wollen oder das ihrem Repräsentanten überlassen. Es soll nicht nur öfter abgestimmt werden, sondern Bürger sollen auch an den Gesetzestexten direkt mitschreiben können. So würde die Spaltung in Regierende und Regierte sowie die Trennung zwischen repräsentativ-demokratischen und direktdemokratischen Entscheidungen aufgehoben. Noch ist man von einer Umsetzung aber weit entfernt: Selbst in Estland, wo man schon online wählen kann und viele staatliche Services digital abrufbar sind, ist Liquid Democracy bis jetzt noch kein Thema.
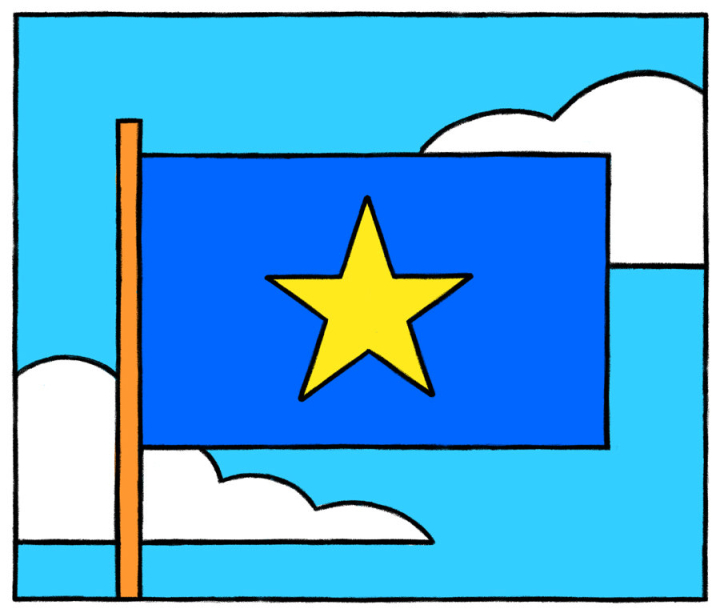
Die Europäische Republik
Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot kritisiert, dass nicht das von den Bürgern gewählte Europäische Parlament am meisten Macht in der EU hat, sondern der Europäische Rat, in dem die Regierungschefs der Mitgliedstaaten zusammenkommen. Die Regierungschefs würden vor allem nationale Interessen vertreten – und weniger die gemeinsamen europäischen Anliegen. Guérot fordert deswegen einen Umbau der EU zu einer Europäischen Republik, eine Ablösung der Nationalstaaten durch ein Europa der Regionen. So würde die Vormachtstellung großer Nationalstaaten wie Deutschland und Frankreich zugunsten vieler fast gleich großer transnationaler Regionen aufgebrochen.
Guérots Ziel: Der Wirtschafts- und Währungsunion soll eine Bürgerunion zur Seite gestellt werden, in der alle EU-Bürger eine gemeinsame EU-Regierung wählen können. Die EU-Bürger müssten sich dann über nationale Grenzen hinweg über ihre Ziele verständigen. Auf diese Weise sollen eine europäische Öffentlichkeit und ein demokratisches „Wir-Gefühl“ jenseits nationaler Grenzen entstehen.
Mehr zum Thema Demokratie gibt's auf bpb.de
Illustrationen: Raúl Soria
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.


