Unter Wellness-Stress
Das allgemeine Streben nach Glück und Gesundheit ist längst zu einer gefährlichen Ideologie geworden, warnen die Organisationstheoretiker Carl Cederström und André Spicer

Eigentlich könnten wir uns alle längst zur perfekten Version unserer selbst optimiert haben: glücklich, fit und produktiv. Wir müssten ja nur literweise grüne Smoothies trinken und den Tag mit einer Yoga-Routine beginnen, mit einer App unseren Schlafzyklus tracken und uns von einer anderen an unser Dankbarkeitsritual erinnern lassen. Wir könnten im Achtsamkeitskurs lernen, auch das Ausfüllen einer Excel-Tabelle zu zelebrieren.
Carl Cederström und André Spicer haben nicht per se etwas dagegen, wenn jemand pürierten Gemüsebrei trinkt, sich beim Yoga verrenkt oder seine Körperfunktionen minutiös überwachen möchte. Die beiden Organisationstheoretiker haben allerdings sehr wohl etwas dagegen, wenn Menschen dazu angehalten werden, sich um die Maximierung ihres Wohlbefindens zu bemühen. Zumal wenn diese Aufforderung nicht vom Hausarzt kommt, sondern von Firmen, Universitäten und Behörden.
Aus Gesundheit wird Ideologie
Die westlichen Gesellschaften leiden an einem „Wellness-Syndrom“, diagnostizieren Cederström und Spicer in ihrem gleichnamigen Essay. Damit meinen sie: Nach Glück und Gesundheit zu streben habe sich zu einer Ideologie entwickelt. Wellness sei zur moralischen Verpflichtung unserer Zeit geworden.
Diese These untermauern sie vor allem mit Beispielen aus den USA und Großbritannien. Sie berichten von Wellness-Verträgen, die Studenten an mindestens einem Dutzend US-Universitäten zu unterschreiben aufgefordert werden und in denen sie sich etwa zu einem alkohol- und drogenfreien Leben verpflichten. Sie verweisen auf Wertpapierhändler, deren Ess- und Schlafgewohnheiten von einer Software analysiert werden und denen Coachings angeboten werden, wenn sie ihre Leistung durch Lebensstilveränderungen verbessern könnten. Und sie schildern die Praxis einiger amerikanischer Krankenhäuser, zukünftige Mitarbeiter zum Urintest zu schicken: Die Kliniken stellen grundsätzlich keine Raucher mehr ein.
Nicht nur das Rauchen an sich wird verurteilt, auch der Raucher selbst ist minderwertig
An solchen Beispielen zeigt sich deutlich, wie sehr die von den Autoren ausgemachte Wellness-Ideologie, die oft als wohlmeinendes „Angebot“ verpackt daherkommt, in die Freiheit des Einzelnen eingreift und einen privaten Lebensstil diktiert. Und sie zeigen, wie sich die moralische Bewertung verschiebt: Nicht nur das Rauchen an sich wird verurteilt, weil es krank macht, sondern auch der Raucher selbst ist minderwertig.
Cederström und Spicer berichten in ihrem Essay auch von einem Unterstützungsprogramm für Arbeitslose, in dem diese von jedweder Spur von Negativität befreit werden sollten, um ihre Erfolgschancen bei der Jobsuche zu vergrößern. Unter anderem wurden sie dazu aufgefordert, ihre Zeit nur mit Leuten zu verbringen, die ihnen positive Gefühle vermitteln, keine Nachrichten zu konsumieren (all die schlechten Meldungen) und sich selbst nicht als „arbeitslos“ zu bezeichnen: Sie seien nämlich „ihr eigener Herr“.
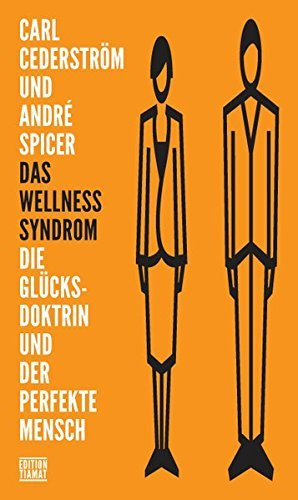
Ermächtigung oder soziale Kontrolle?
Sogar solche teilweise absurd anmutenden Wellness-Techniken klingen erst mal ermächtigend. Sie vermitteln den Betroffenen das Gefühl, sie können ihr Schicksal aus eigener Kraft ändern. Allerdings kommt diese Ermächtigung nicht ohne eine Kehrseite, warnen die Autoren. Wenn wir glauben, dass wir nur genug an uns arbeiten müssen, um glücklich und erfolgreich zu werden, bedeutet das ebenfalls: Wer scheitert, hat sich nicht genug angestrengt und ist damit selbst schuld. Dass es zum Beispiel für Arbeitslosigkeit auch strukturelle Ursachen gibt, an denen der Einzelne nichts ändern kann, gerät aus dem Blickfeld. Wenn wir nur noch um uns selbst und unsere eigenen Unzulänglichkeiten kreisen, nehmen wir die „Krankheit der Welt“ nicht mehr wahr.
Ein Plädoyer gegen die Entsolidarisierung
Cederströms und Spicers scharfe Kritik am Wellness-Wahn ist letztendlich ein starkes Plädoyer gegen die Entsolidarisierung der Gesellschaft: Sie gruseln sich vor einem narzisstischen, kalten Nebeneinanderherleben, bei dem sich der Einzelne nur noch obsessiv mit sich selbst und dem eigenen Wohlbefinden beschäftigt. Einer Gesellschaft, die nach dem Prinzip des „Survival of the Fittest“ funktioniert und in der die Verantwortung für das gute Leben individualisiert wird.
Cederströms und Spicers einseitiges Betonen des Terrorpotenzials von Wellness-Angeboten nervt zwar manchmal ein bisschen. Aber dass uns Yoga und der tägliche Apfel guttun, das wissen wir ja mittlerweile.
Titelbild: Lauren Greenfield/INSTITUTE