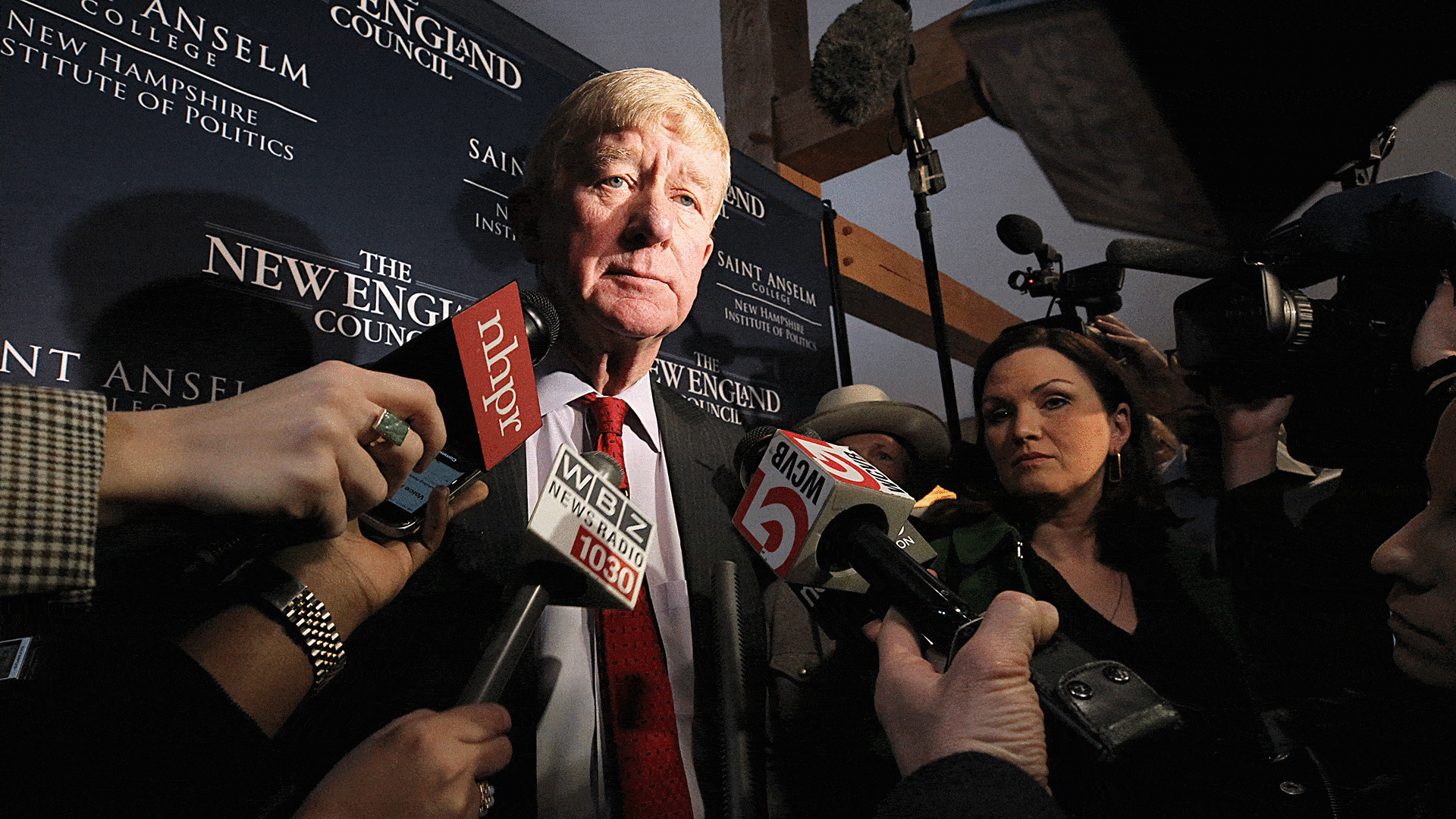Der äußerste Außenseiter
Bill Weld will, was viele für unmöglich halten: den Präsidenten aus der eigenen Partei entmachten. Seine Botschaft: Nicht alle Republikaner sind wie Trump
Im November 2020 will Donald Trump wieder zum US-Präsidenten gewählt werden. Der Wahlkampf läuft bereits: Über 20 Kandidat*innen der Demokratischen Partei wollen gegen ihn antreten – und ein Republikaner.
Demokraten gegen Donald Trump – so könnte man den US-Wahlkampf betiteln. Stimmt in etwa, aber nicht ganz. Auch bei den Republikanern regt sich Opposition gegen die amtierende Regierung. Zumindest eine kleine.
William „Bill“ Weld heißt der Mann, der schaffen möchte, was keinem Kandidaten seit 1852 gelungen ist: den Präsidenten aus der eigenen Partei entmachten.
Die Chancen des 73-Jährigen sind minimal – das weiß er, das weiß Trump, das wissen eigentlich alle. Und doch tingelt Weld, der von 1991 bis 1997 Gouverneur von Massachusetts war, seit einigen Monaten von Town Halls zu Radiostationen zu Kneipen, um seinen Protest unters Volk zu bringen. Trump sei böse, sagt Weld, aber nicht alle Republikaner seien wie Trump.
Alter: 73
Position: Ehemaliger Gouverneur von Massachusetts
Wahlkampfthemen: Außenpolitische Beziehungen zu westlichen Ländern, Klimaschutz, Steuersenkungen
Basis: Republikaner, die Trump nicht ausstehen können
Wahlkampfspenden: 688.000 Dollar
„Washington versinkt gegenwärtig im Chaos, Wahrheit bedeutet nichts mehr, doch Amerika hat die Wahl“, heißt es in einem seiner Wahlkampfvideos. In Interviews, auf Veranstaltungen und bei Twitter wird Weld deutlicher: Trump sei gefährlich, ein Krimineller, nicht „fit for office“ und müsse deshalb des Amtes enthoben werden. Sogar mit Diktatoren wie Nero oder Caligula hat Weld den amtierenden Präsidenten schon verglichen. In puncto Attacken schießt Weld schärfer als die 20 Kandidat*innen der Demokratischen Partei.
Wer ist dieser Mann, der sich mit dem Präsidenten und der eigenen Partei anlegen möchte? Einer, „der nichts zu verlieren hat“, sagt Weld selbst. Er wurde im Bundesstaat New York geboren, studierte in Harvard und Oxford, verbrachte den größten Teil seines Lebens in Massachusetts und arbeitet bis heute als Anwalt. Unter dem Präsidenten Ronald Reagan Präsident arbeitete Weld im Justizministerium. Ein paar Jahrzehnte später sprach er sich dafür aus, dass Barack Obama ins Weiße Haus einzieht, ehe er sich 2012 wieder hinter den republikanischen Kandidaten Mitt Romney stellte. 2016 trat Weld schließlich als „Running Mate“ (Kandidat für die Vizepräsidentschaft) des Libertären Gary Johnson an.
Man könnte Weld als Querdenker bezeichnen. Oder als Wirrkopf. Loyalität gegenüber seiner Partei scheint er jedenfalls nicht zu verspüren.
Wenn es um Wirtschaftspolitik geht, ist Weld aber ein typischer Republikaner: niedrige Steuern, wenig staatliche Regulationen, freier Handel und Markt – das ist seine Vision. Bei gesellschaftspolitischen Fragen zeigt er sich liberaler. Weld befürwortet die gleichgeschlechtliche Ehe, setzt sich für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ein, Umweltschutz und den medizinischen Einsatz von Marihuana. So verzerrt die Perspektive für manche Beobachter auch sein mag: Konservative Republikaner sehen in Bill Weld einen Linken, nicht unterscheidbar von den meisten Demokraten. Besonders besorgt gibt sich Weld bezüglich der US-amerikanischen Außenpolitik. Während Trump „Verbündete beleidigt“, kuschle er gleichzeitig mit „despotischen Führern“.
Weld möchte die Republikaner vor Trump retten. Doch will sich seine Partei überhaupt retten lassen? Viele Kollegen, glaubt Weld, ständen dem Präsidenten kritisch gegenüber, trauten sich aber nicht, ihn öffentlich zu kritisieren. Und die Wähler? In Umfragen geben meist zwischen 80 und 90 Prozent der befragten Republikaner an, dass sie Trump wiederwählen werden.
Weld ist so etwas wie der äußerste Außenseiter, eine Hoffnung aber bleibt ihm: eine öffentliche TV-Debatte mit Trump. „Ich verspreche euch, im nächsten Jahr werde ich bei weit über 15 Prozent in den Umfragen stehen“, sagte er Ende Juni in einem Interview, „was bedeuten würde, dass mir nach den Vorschriften eine Debatte mit Mr. Trump zusteht.“
Titelfoto: Suzanne Kreiter/The Boston Globe via Getty Images
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.