Wir suchen ein Endlager
Deutschland sitzt auf einem Berg von Atommüll. Wo bleiben mit dem Material, das für Jahrtausende strahlen wird? Ein weltweit einmaliger Entscheidungsprozess soll es richten
Deutschland sitzt auf einem Berg von Atommüll, daran ändert auch die eingeleitete Energiewende nichts. Wenn 2022 das letzte deutsche Kernkraftwerk vom Netz gehen soll, müssen insgesamt rund 30.000 Kubikmeter hochradioaktive Abfallstoffe entsorgt werden. Möglicherweise kommt noch eine erhebliche Menge an schwach- und mittelradioaktiven Abfällen hinzu, die eigentlich im Schacht Konrad in Salzgitter gelagert werden sollten, dort jedoch wahrscheinlich keinen Platz mehr finden.
Wo aber kann solch ein Endlager gebaut werden? Und wie muss es aussehen? Ein Gremium mit dem etwas sperrigen Namen Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe (kurz: Endlagerkommission) hat zwei Jahre lang über diese und andere Fragen gebrütet. In ihrem vor kurzem vorgelegten Abschlussbericht hat die Kommission zwar keine endgültigen Antworten darauf gegeben. Doch das aus Atomkraftgegnern und -befürwortern zusammengesetzte Gremium hat Historisches geleistet: Es hat einen weltweit bislang einmaligen Entscheidungsprozess in Gang gesetzt, an dessen Ende die Einigung über ein Endlager stehen soll, die von der gesamten Gesellschaft mitgetragen wird.
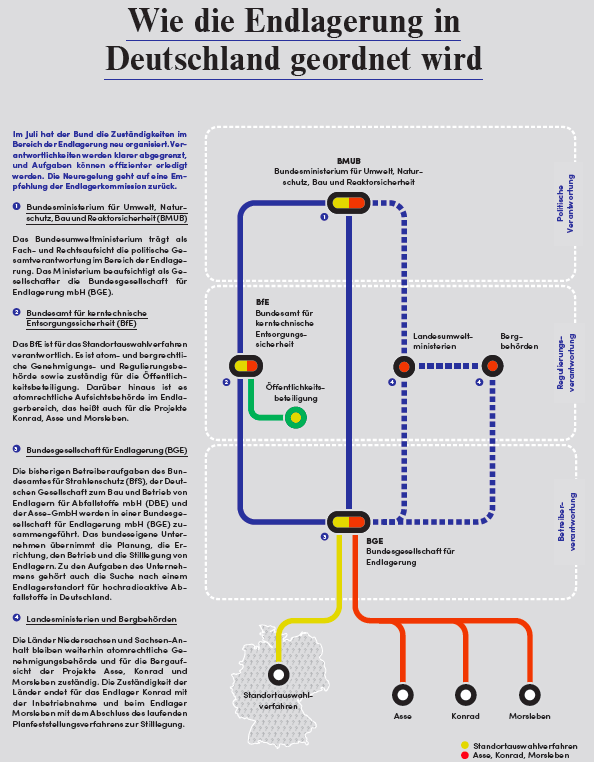
Festgelegt wurden nur Kriterien, auf deren Grundlage der Standort eines Endlagers bestimmen werden soll
Doch bis dahin dürfte es noch ein langer und steiniger Weg sein. Was die 34 Abgeordneten, Industrievertreter, Wissenschaftler, Gewerkschafter, Umweltschützer und Kirchenleute zunächst einmal festgelegt haben, sind Kriterien und Empfehlungen, auf deren Grundlage die der Bundesrat, Bundestag und die Bundesregierung den Standort eines Endlagers bestimmen soll. Und auch dieses Ergebnis ist nicht einstimmig erreicht worden. So lehnte etwa der in der Kommission vertretene Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) den Abschlussbericht ab, weil darin auch der jahrzehntelang ausschließlich fokussierte Salzstock im niedersächsischen Gorleben als möglicher Endlagerstandort nicht ausgeschlossen wird – trotz der dortigen geologischen Probleme, die aus Sicht der Gorleben-Kritiker gegen eine sichere Endlagerung von Atommüll sprechen.
„Verantwortung für die Zukunft“ lautet der Titel des Abschlussberichts. In dem mit Anhängen fast 700 Seiten langen Bericht ist sich die Endlagerkommission darin einig, dass man bei der Suche nach dem Standort von einer „weißen Landkarte“ ausgehen müsse, dass also alle Regionen in Betracht gezogen werden sollen und keines der drei als potentiell geeignete Wirtsgesteine Salz, Ton oder Kristallin ausgenommen werden dürfe. Der Ko-Vorsitzende des Gremiums, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Michael Müller, mahnte eine faire Debatte an. Es gehe nicht um die Frage: „Endlager Ja oder Nein“, sondern es gehe um das „Wo und Wie“, sagte er bei der Vorstellung des Berichts. Die Empfehlungen der Kommission werden in das zu reformierende Standortauswahlgesetz einfließen, das der Gesetzgeber im kommenden Herbst überarbeiten wird.
Die wichtigsten Empfehlungen, die die Kommission für die Einlagerung des deutschen Atommülls festgelegt hat: Das Endlager muss in Deutschland entstehen, eine Ausfuhr radioaktiver Abfälle aus den Kernkraftwerken in andere Länder soll gesetzlich unterbunden werden. Außerdem muss ein Endlager unterirdisch in größerer Tiefe angelegt werden, so dass die sogenannten „geologischen Barrieren“, also das Deckgebirge und das umschließende Wirtsgestein, über einen Zeitraum von Jahrtausenden eine stabile Umgebung bieten.
Im Notfall soll zurückgeholt werden, auch noch nach 500 Jahren
Damit diese Sicherheit zu gewährleisten ist, legt der Bericht genaue Mindestanforderungen bezüglich Wasserdurchlässigkeit, Wärmeleitfähigkeit und seismische Aktivität fest. Sichergestellt muss aber auch sein, dass die Behälter mit dem Atommüll im Notfall zurückgeholt werden können – und zwar nicht nur in der Zeit, in der das Endlager sich in aktivem Betrieb befindet, sondern auch noch über einen Zeitraum von weiteren 500 Jahren, nachdem es wie geplant irgendwann verschlossen worden ist.
Die Auswahl eines Endlagers soll in drei Etappen erfolgen. Zunächst werden auf der Basis der definierten Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen potenzielle Standorte zusammengestellt. Das Ergebnis dieser Vor-Suche beschließen Bundestag und Bundesrat.
In der zweiten Phase des Auswahlprozesses werden die als mögliche Standorte identifizierten Regionen genauer untersucht. Experten gehen von etwa 60 Regionen in Deutschland aus, in denen es Formationen mit den Wirtsgesteinen Salz, Kristallin oder Ton gibt. Welche dieser Regionen für ein Atommüll-Endlager besonders geeignet wären, soll zunächst mit oberirdischen Untersuchungen analysiert werden. Auch das Ergebnis dieser Analyse werden Bundestag und Bundesrat beschließen.
Die Einlagerung dürfte sich über mehrere Jahrzehnte hinziehen
In der dritten Etappe schließlich sollen die noch verbliebenen Standorte auch unter der Erde erkundet werden mit dem Ziel, „den bestmöglichen Standort zu bestimmen“, wie es im Kommissionsbericht heißt. Basierend auf dem Ausgang dieser Untersuchung sollen dann Bundestag und Bundesrat die Entscheidung für das Endlager in einem Bundesgesetz beschließen.
Wann das sein könnte, darauf legt sich der Abschlussbericht nicht fest. Die Bundesregierung geht von einer Standortfestlegung frühestens um das Jahr 2032 aus, hält aber auch einen Zeitraum von 40 bis 60 Jahren für denkbar. Nach der Festlegung soll der Bau des Endlagers beginnen, für den knapp zwei Jahrzehnte veranschlagt werden. Erst dann kann die sorgsame Einlagerung des Atommülls beginnen. Sie dürfte sich nach Expertenschätzungen über mehrere Jahrzehnte hinziehen.
In ihrem Bericht hat die Kommission auch festgelegt, wie die Öffentlichkeit an allen drei Phasen des Entscheidungsprozesses aktiv beteiligt werden soll. So wird auf Bundesebene ein bereits beschlossenes „nationales Begleitgremium“ aus sechs „anerkannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“ und drei zufällig ermittelten Bürgern einberufen werden. Dieses Gremium soll als unabhängige gesellschaftliche Instanz das Such- und Auswahlverfahren neutral, aber mit Fachwissen begleiten. Zu diesem Zweck werden die Mitglieder Einsicht erhalten in alle Akten und Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren angelegt werden. Das Gremium soll diese Inhalte beraten sowie Stellungnahmen und Empfehlungen erarbeiten, die anschließend veröffentlicht werden – einschließlich möglicher abweichender Sondervoten.
Es sollen Regionalkonferenzen organisiert werden, bei denen Anwohner sich informieren und einbringen können
Nach der ersten Etappe des Auswahlprozesses werden zudem in allen betreffenden Regionen Regionalkonferenzen organisiert, bei denen Anwohner sich informieren und einbringen können. Diesen Regionalkonferenzen werden Vertreter der Kommunen, gesellschaftlicher Gruppen und einzelne Bürger angehören. Zudem sollen überregionale Räte einen Austausch zwischen den betroffenen Regionen fördern.
Wenn schließlich die Wahl auf einen Endlagerstandort gefallen ist, soll es mit der betroffenen Region eine Standortvereinbarung geben. Sie soll den Nachweis enthalten, dass es sich um den bestmöglichen Standort handelt und die Region in der Lage ist, unter Zusicherung staatlicher Betriebsbegleitung die Belastungen durch den Bau des Lagers und den Behältertransport dauerhaft auszugleichen. Außerdem soll diese Vereinbarung auch langfristige Entwicklungsstrategien für die vom Endlager betroffene Region beinhalten, mit denen möglichen negativen Nebeneffekten der Standortentscheidung – beispielsweise Imageverlust und Rückgang von Tourismuszahlen – begegnet werden kann. Diese Strategien sollen über einen kurzfristigen finanziellen Ausgleich hinausgehen und auch generationenübergreifend die Entwicklungspotenziale der Region stärken.
Noch unklar jedoch ist, wie bis zur Fertigstellung eines Endlagers mit dem Atommüll weiter verfahren werden soll. Gegenwärtig werden diese hochradioaktiven Abfälle in oberirdischen Zwischenlagern aufbewahrt, die sich meist an den alten Atommeilern befinden, aber auch an Standorten wie Ahaus und Gorleben. Die Genehmigungen für die meisten dieser Zwischenlager laufen im Jahre 2046/2047 aus. Dann ist wahrscheinlich noch kein Standort für das Endlager beschlossen, an dem man ein zentrales Zwischenlager für den derzeit noch auf 16 Standorte verteilten Atommüll errichten könnte. Da jedoch niemand die tatsächliche Dauer des Auswahlverfahrens sicher voraussagen kann, könnte das Thema Zwischenlager schon in ein paar Jahren drängend werden.
Titelbild: Michael Danner/laif