Das bringt uns noch um
Antibiotika sind eine der größten Errungenschaften der Medizin. Aber viele helfen kaum mehr gegen gefährliche Keime – und jedes Jahr sterben Millionen Menschen. Was ist da los?
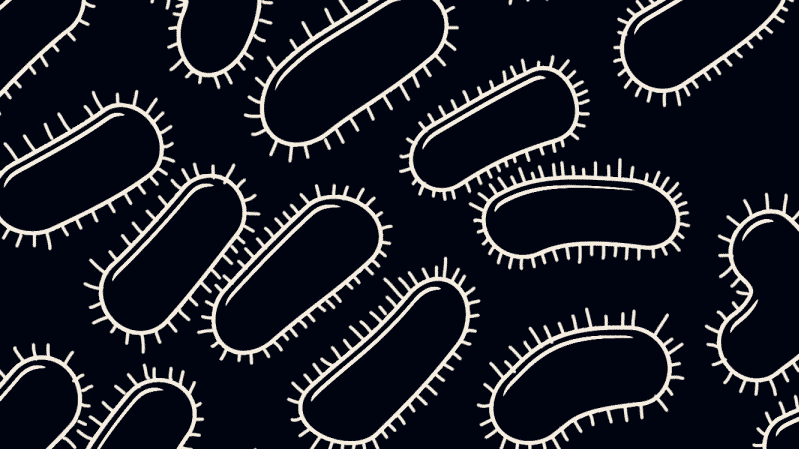
Multiresistente Keime sind hinterhältig. Sie lauern auf Türklinken, treiben im Abwasser, stecken im Steak. Und noch biestiger macht sie: ihre Anpassungsfähigkeit.
Weil die immer besser wird, könnten laut Forschern im Jahr 2050 rund zehn Millionen Menschen an einer Infektion mit einem resistenten Erreger sterben. Bakterien also, die sich den Antibiotika anpassen und somit nicht mit den üblichen Arzneimitteln bekämpft werden können. Antibiotikaresistenzen sind eine der häufigsten Todesursachen, besonders in ärmeren Ländern, in denen insgesamt deutlich mehr Menschen an Infektionskrankheiten sterben. 2019 waren Antibiotikaresistenzen weltweit für den Tod von fast fünf Millionen Menschen verantwortlich oder mitverantwortlich. Zum Vergleich: An einer HIV/Aids-Infektion starben 2020 geschätzt 680.000 Menschen, an Malaria 627.000.
Bakterien sind eine besondere Art von Keimen, genauso wie Viren, Parasiten oder Pilze
Wo liegt das Problem?, könnte man fragen: Wir haben doch Antibiotika, die ultimativen Mittel gegen Infektionskrankheiten, irgendeines wird schon wirken. Und wenn nicht, muss halt ein neues her. So einfach, oder?
Antibiotika können nicht endlos weiterentwickelt werden
„Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir nur ein neues Antibiotikum brauchen und das Problem damit gelöst ist“, sagt Tim Eckmanns. Er leitet am Robert-Koch-Institut (RKI) die Abteilung für „Überwachung von Antibiotikaresistenz und -verbrauch“. Ständig neue Mittel zu entwickeln und einzusetzen sei, als würde man einem Alkoholiker immer wieder eine neue Sorte Brandy einschenken. Ist im ersten Moment nett – aber bald muss neuer Stoff her. Die Wirkung verpufft. Und – zack! – ist da eine weitere Resistenz.
Wie schnell das geht, zeigt ein Versuch der Harvard Medical School. Ihr Versuchsaufbau: eine überdimensionale Petrischale mit Antibiotika, deren Konzentration vom Rand zur Mitte zunimmt. Man kann sich das wie den Einlass vor einem Club vorstellen: Am Rand steht die Spelunke, in die jeder kommt, dann die Dorfdisco, die nur die Betrunkensten wegschickt, und in der Mitte die Tür vom Berghain (dieser Berliner Club, der Macklemore und Britney Spears abwimmelte). Dann kommen die Keime ins Spiel. Sie starten in der Spelunke. Um in den nächsten Club zu gelangen, müssen sie resistent werden. Innerhalb von elf Tagen mutierten die Erreger und überrannten das Berghain. Das Experiment zeigt: Wie stark die Türsteher (also die Antibiotika) auch sind, die Keime sind stärker. Und schneller. In elf Tagen kann kein Forschungsteam der Welt ein neues Antibiotikum entwickeln. Womöglich nicht mal in elf Jahren.
In diesem bislang hoffnungslosen Wettrennen machen gerade neue Antibiotikaklassen Hoffnung. Cresomycin und Zosurabalpin sollen gegen hochresistente Bakterien wirken. Sollte eines der Mittel zugelassen werden, wäre es das erste neue Antibiotikum seit rund zehn Jahren.
Es gibt kaum Forschung zu Resistenzen
Die Entwicklung von Antibiotika ist komplex. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, weshalb es selten neue Mittel gibt, sagt Peter Beyer, der als Jurist lange für die WHO gearbeitet hat. Kaum ein Pharmaunternehmen forsche heute an Antibiotika. „Es lohnt sich einfach nicht“, sagt Beyer.
Hierzulande sterben laut Schätzungen jedes Jahr knapp 10.000 Menschen an Antibiotikaresistenzen. Weil Deutschland und Europa vergleichsweise wenig betroffen sind, seien auch die potenziellen Einnahmen und damit die Anreize für Forschung geringer, sagt Beyer.
Die Global Antibiotic Research and Development Partnership, kurz GARDP, will die Wirksamkeit von Antibiotika bewahren. Deshalb arbeitet die Organisation auch an der Entwicklung neuer Antibiotika. Seit 2022 ist Peter Beyer dort stellvertretender Geschäftsführer. Dank der Gelder von Ministerien, Ländern und Stiftungen weltweit muss GARDP nicht profitabel arbeiten. „Aber selbst wenn wir ein neues Mittel finden, sollte es eigentlich kaum eingesetzt werden“, sagt Beyer.
Da gibt es endlich ein Wundermittel gegen eine globale Gesundheitsbedrohung, und dann soll man es nicht einsetzen? Dass womöglich ein neues Antibiotikum zugelassen wird, wäre durchaus ein Durchbruch, sagt Tim Eckmanns vom RKI. Aber – und da stimmen Peter Beyer und andere Experten zu – wichtiger als ein neues Antibiotikum sei, wie man es einsetzt. Wichtig ist, dass dem Erreger entsprechende Antibiotika verschrieben werden statt flächendeckend auf Mittel zu setzen, die viele verschiedene Bakterien angreifen, also sogenannte Breitspektrumantibiotika. Mit denen würde ein Patient zwar auch gesund, aber das Mittel verliert mit der Zeit seine Wirksamkeit. Um das zu verhindern, werden Reserveantibiotika zurückgehalten.
Besser spezifische Antibiotika als Alleskönner
Genauere medizinische Diagnosen können helfen, sagt Eckmanns. Damit ein spezifisches Antibiotikum verabreicht wird, nicht ein Alleskönner, der beim nächsten Mal vielleicht weniger oder gar nicht mehr wirkt. Und natürlich ein sorgsamerer Einsatz in der Massentierhaltung, in der Antibiotikagaben die Regel sind, damit sich die riesigen Tierherden nicht gegenseitig infizieren. Um das umzusetzen, arbeiten Forscher wie Eckmanns an Konzepten, die Namen tragen wie Antibiotic Stewardship: Was muss vor der Medikamentierung geschehen (Stichwort: Diagnose), und wie soll das Antibiotikum eingenommen werden (dreimal am Tag heißt nicht morgens, mittags, abends – sondern alle acht Stunden)? „Jedes Antibiotikum, das gegeben wird, muss gut überlegt sein, weil jede Gabe die Gefahr einer Resistenzentwicklung erhöht“, sagt Eckmanns.
Neu ist das eigentlich nicht. 1945 bekam Alexander Fleming den Nobelpreis für die Entwicklung von Penicillin, dem allerersten Antibiotikum. Sinngemäß sagte er: Wenn wir dieses Mittel verantwortungslos einsetzen, werden wir es verlieren.
Animation: Vincenzo Lodigiani
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.