Bau ab, bau ab
Wie schrumpft eine Stadt vernünftig, wenn die Einwohner in Scharen davonziehen? In Eisenhüttenstadt kann man darauf eine Antwort finden
Die Eisenhüttenstädter sind ja verwöhnt. Das sagt Gabriele Haubold, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung im Fachbereich Stadtumbau und seit fast 60 Jahren hier. „Denn bis 1990 wurde ja immer investiert, immer neu gebaut. Die Stadt wuchs und wuchs. Und im gleichen Maße schrumpft sie jetzt.“
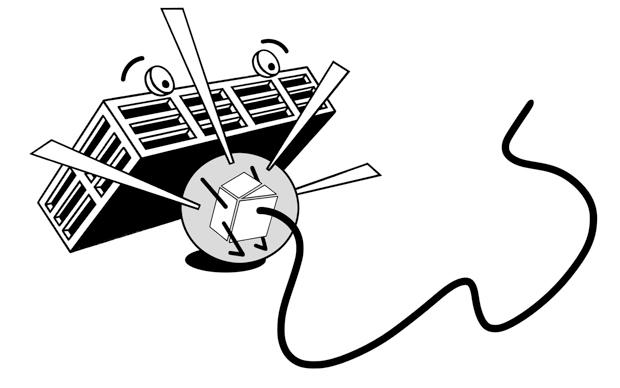
Eine besondere Stadt war Eisenhüttenstadt von Anfang an. Jung ist sie, geboren wurde sie erst 1950, als die junge DDR ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern und ausstellen wollte und dafür in der Niederlausitz, im äußersten Osten des Landes, ein Eisenhüttenkombinat baute, eine Industrieanlage zur Herstellung von Roheisen und Stahl aus sowjetischem Erz und Koks. Dessen Arbeiter sollten mit ihren Familien nicht bloß in einer Schlafsiedlung wohnen, nein, eine sozialistische Idealstadt sollte für sie entstehen.
Und so wurde beim Bau der ersten drei Wohnkomplexe, wie die für mehrere Tausend Menschen ausgelegten Stadtteile hier heißen, geklotzt. Sie bieten Vorzeigearchitektur, häufig im Stil des sozialistischen Klassizismus, mit Torbögen und Arkadengängen, Säulen und Pilastern. Die Straßen sind von großzügigem Ausmaß und die viergeschossigen Wohnhäuser umfassen große Grünanlagen.
Weit ist die Stadt und um so weiter wirkt sie heute, da zwischen den Häusern oft triste Leere herrscht. Denn Menschen trifft man bei einem Spaziergang durch Eisenhüttenstadt nicht viele. Und gäbe es nicht die überfüllte Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, wären es noch weniger. 27.552 Einwohner hatte Eisenhüttenstadt im November 2014; 1990, im Jahr der deutschen Wiedervereinigung, waren es noch über 50.000.
Wer konnte, der ging. Und das waren vor allem die Jüngeren
Danach brach die Wirtschaft der ehemaligen DDR zusammen. Das Stahlwerk arbeitet zwar bis heute, inzwischen betrieben vom luxemburgischen Weltmarktführer ArcelorMittal. Doch statt wie früher 12.000 Menschen sind nur noch rund 2.500 Leute hier beschäftigt. Vor allem für Frauen, von denen in der DDR viel mehr berufstätig waren, gab es nach 1990 kaum noch eine Perspektive. Die Folge: Wer konnte, der ging. Und das waren vor allem die, die erst in den 80er-Jahren gekommen war. Die Jüngeren. Die Qualifizierteren. Wie in so vielen Städten im Osten.
Was aber macht man, wenn die Stadt schrumpft? Als Erstes braucht es Einsicht. Dass die Leute nicht mehr wiederkommen – und erst recht keine neuen. Schon 1995 prognostizierten Stadtforscher eine solche Entwicklung für die neuen Bundesländer. Deshalb begann Eisenhüttenstadts Verwaltung 2001 damit aufzuräumen. Andere Städte in Ostdeutschland reagierten nicht so überlegt und schnell. „Die haben den Schuss nicht gehört“, meint Gabriele Haubold, die den Rückbau mitorganisiert hat.
Eisenhüttenstadts spezielle Situation: Der historische Stadtkern bildet das größte zusammenhängende Denkmalschutzgebiet in Deutschland. Bloß waren diese Musterwohnungen des Sozialismus fast alle unsaniert. Die später gebauten Plattenbauten am Rand hingegen sind moderner, außerdem hatten private Wohnungsgesellschaften nach der Wende in sie investiert und so Tatsachen geschaffen. Deshalb nahm die Stadtverwaltung als einen ihrer ersten Schritte eine sogenannte Portfolioanalyse vor. Dabei wurden sämtliche Wohnkomplexe untersucht: Wie viele Menschen wohnen noch dort? Was steht leer? Wie viele Ein-, Zwei-, Dreiraumwohnungen werden benötigt? Wo wollen die Leute hin? Und was können sie zahlen?
Das Ergebnis: Man solle den Stadtkern aufgeben und den Rand stärken. Für Gabriele Haubold und die anderen Planer war das allerdings keine Lösung. Sie machten vielmehr genau das Gegenteil: Im Innenstadtbereich wurde saniert – und am Rand gestrichen. Finanziert wurde diese Maßnahme auch vom Bund. Im Rahmen des Programms „Stadtumbau Ost“ flossen seit 2002 insgesamt rund drei Milliarden Euro an ostdeutsche Kommunen.
Wo einst ein Stadtteil war, ist heute nur ein Wiesenmeer
Auf Vorher-nachher-Luftaufnahmen von Eisenhüttenstadt kann man inzwischen gut erkennen, was seitdem passiert ist: Im Stadtkern fehlen nur wenige Gebäude. In den Wohnkomplexen V und VI, die in Plattenbauweise errichtet wurden und kaum etwas mit der Eleganz der Innenstadt zu tun hatten, existieren hingegen ganze Häuser nicht mehr. Und vom Wohnkomplex VII ist praktisch nichts mehr übrig: Von einst 3.141 Wohneinheiten gibt es nur noch 342. Wenn man heute dort vorbeifährt, blickt man auf ein blühendes Wiesenmeer. Das Unkraut hat sich die Flächen längst einverleibt, und eine Gruppe Tauben fliegt in Formation darüber hinweg. Lediglich die Asphalttrassen der früheren Straßen lassen erahnen, dass hier einmal einige Tausend Menschen lebten.
Die Mieter in den städtischen Wohnungen wehrten sich anfangs. Sie gründeten Initiativen, sammelten Unterschriften, schrieben wütende Briefe an die Stadtverwaltung. „Im Rathaus werden die Toiletten saniert, aber unser Block soll weg“, liest Gabriele Haubold aus einem dieser Schreiben vor. Sie zeigt sich wenig sentimental, dabei hätte sie sogar Grund dazu: In den 1980er-Jahren hatte die ausgebildete Architektin Haubold noch am Wohnkomplex VII mitgewirkt.
Eine Alternative zum Rückbau sieht sie nicht. Was würde es bringen, wenn eine Stadt aus vielen halb leeren Wohnungsblöcken besteht statt aus wenigen belebten? „Spätestens wenn man dann zur dem kommt, was unter der Erde ist, dann machen diese Zahnlücken in einem Stadtgebilde keinen Sinn mehr“, sagt Haubold. Denn die Bereitstellung von Strom, Telefonleitungen, Kanalisation ist immer gleich teuer, egal wie viele Menschen in einem Viertel wohnen.
„Busse, Straßenbeleuchtung, auch die Freiflächenpflege, alles ist ja auf eine Einwohnerzahl ausgerichtet. Wenn Sie in einem Gebiet, das für 9.000 Einwohner vorgesehen war, nur noch 360 versorgen müssen, können Sie sich vorstellen, gibt’s Probleme“, erklärt Haubold. „Am Ende haben Sie dann eine Geisterstadt, wo aber noch eine Kita ist, weil es da noch drei Kinder gibt.“ Auch die Heizkosten in einem halb leeren Haus sind pro Haushalt höher, weil man für die leeren Nachbarwohnungen mitheizt. „Den Leerstand bezahlt man dann auch selber“, fügt Gabriele Haubold hinzu. Aber das machten sich die wenigsten klar.
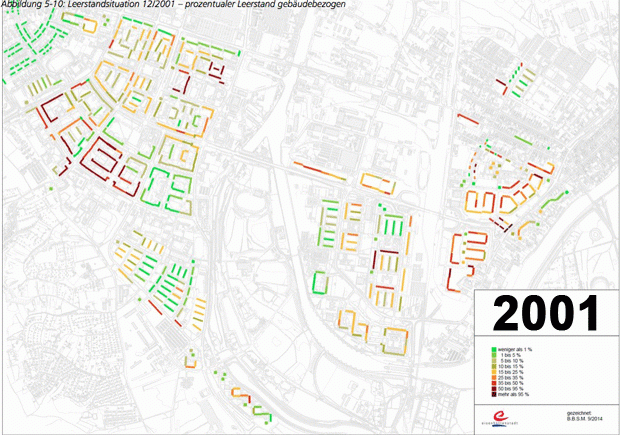
„Eisenhüttenstadt war früher durch seine Zuzüge immer eine junge Stadt“, sagt Haubold. Nun ist es eine alte: Nur 11,7 Prozent der Bewohner sind unter 18, dafür 28,7 Prozent über 65 Jahre alt. Der Durchschnitt liegt bei 49,1 Jahren, das ist rund fünf Jahre höher als der bundesdeutsche Bevölkerungsdurchschnitt. Einige wurden weitergenutzt, in einer ist nun das „Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR“ mit über 170.000 Exponaten untergebracht. Doch die Sache mit den „weichen Standortfaktoren“ – also der Ansiedelung von Kulturangeboten oder anderen Dingen, die Eisenhüttenstadt vielleicht als Wohnort für Pendler nach Frankfurt an der Oder oder gar nach Berlin attraktiv machen könnten – will noch nicht so recht klappen. Eine Imagebroschüre bewirbt das „seit 1997 aufgeführte Musical ‚Schneemann Snowy‘“.
„Wir wissen nicht, ob wir alles richtig machen“, gesteht Gabriele Haubold selbstkritisch, betont aber gleichzeitig: „Wir haben den Anspruch, keine sanierte Wohnung abzureißen, und das haben wir bisher durchgehalten.“ Elf Prozent Leerstand wies Eisenhüttenstadt Ende 2014 auf. Eine Menge? Ohne den Rückbau von über 6.000 Wohneinheiten wären es über 30 Prozent.
Auf 22.000 Menschen soll die Bevölkerung Eisenhüttenstadts Prognosen zufolge bis 2030 zurückgehen. Es wird noch mehr abgerissen. Und die Leute werden weiter schimpfen. „Der Stadtumbau ist immer noch negativ belegt. Sie werden wenige treffen, die sagen: Es ist okay“, sagt Gabriele Haubold. Was es heißt, aus der eigenen Wohnung rauszumüssen, weil der Häuserblock verschwindet, weiß sie recht gut. Auch ihre Wohnung wurde abgerissen, anderthalb Jahre lebte sie in einem Übergangsapartment – bis die neue bezugsfertig war.
Michael Brake ist freier Journalist aus Berlin und in der fluter.de-Redaktion für Kulturthemen zuständig