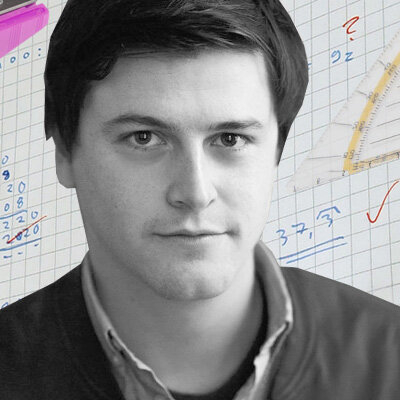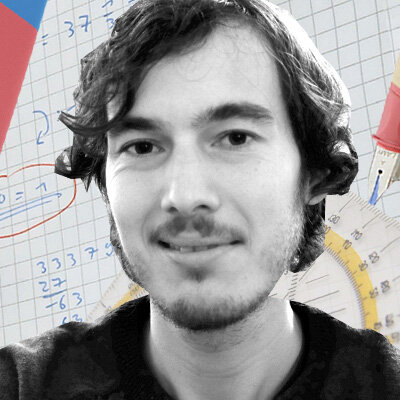Brauchen wir Noten?
Nie wieder wegen der Fünf der Klassenloser sein – dafür aber weniger Klarheit über die eigene Leistung haben? Unsere Autoren streiten
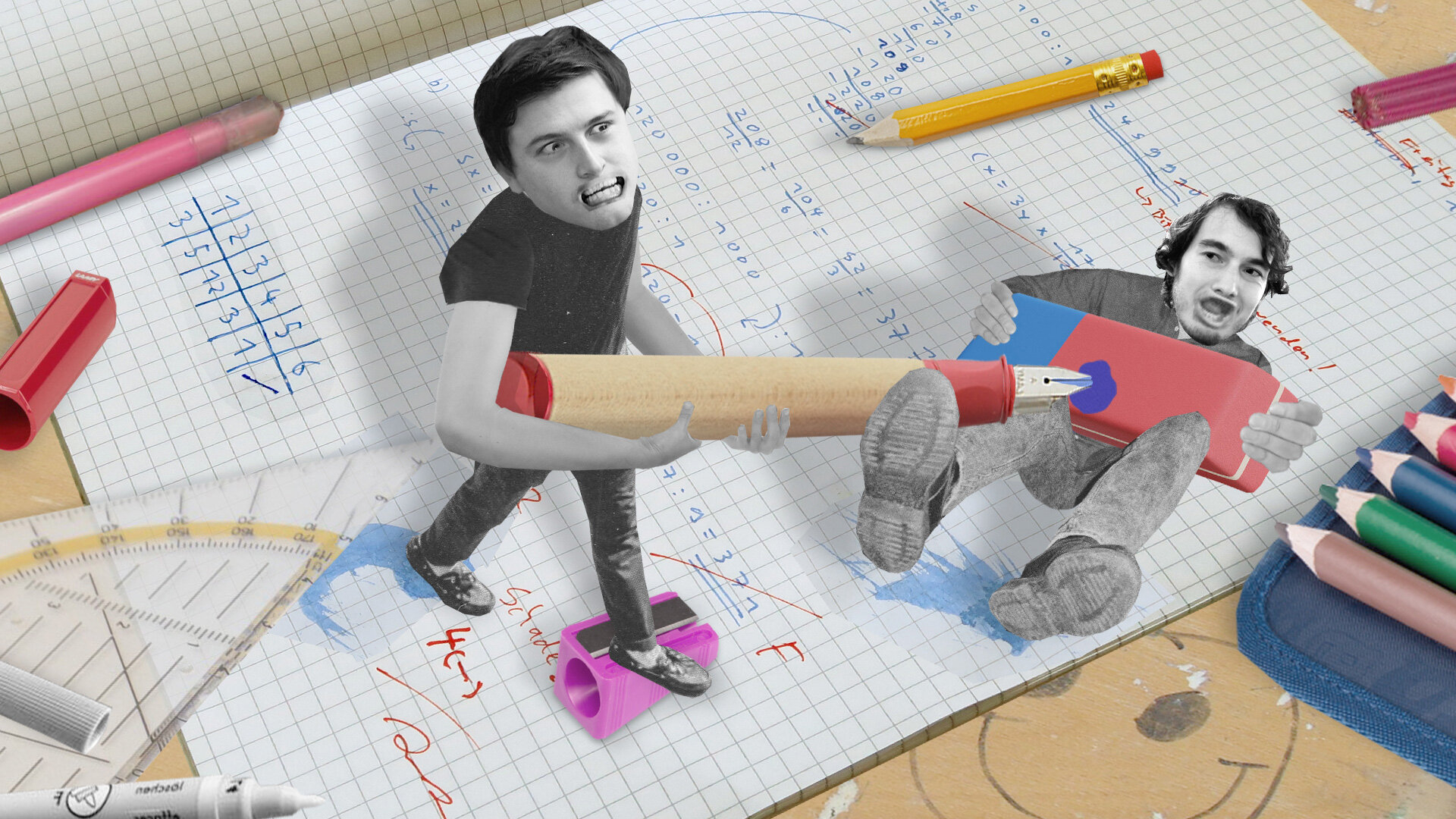
Behalten, sie geben klare Orientierung
sagt Benjamin Breitegger
Noten sind ungerecht. Kein Einspruch. „Es gibt allenfalls das Bemühen, niemandem unrecht zu tun. Mehr können auch Noten nicht leisten“, sagte der mittlerweile emeritierte Universitätsprofessor für Schulpädagogik Werner Wiater einmal in einem Interview. Die absolut gerechte, objektive Bewertung wird es nie geben, weder in der Schule noch später im Leben.
Noten erfüllen einen anderen Zweck: Sie geben Orientierung. Sie sagen mir: Wie ist meine Leistung aktuell? Sie stehen auch nicht im Widerspruch zu differenzierten Beurteilungen. Die erfolgen sowieso, mündlich, während des gesamten Schuljahres. Lehrerinnen und Lehrer erklären den Kindern und Jugendlichen, was sie gut können und was nicht so gut. Wo sie sich verbessern können. Sie gehen auf unterschiedliche Persönlichkeiten ein.
Die Note ist nur eine Zusammenfassung der Leistungen. Eine, mit der Schülerinnen und Schüler und später Studierende sich zumindest klassenintern vergleichen können – und die motivieren kann, sich zu verbessern.
Selbst die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ist für Noten
In manchen Grundschulen – die Bundesländer haben unterschiedliche Regelungen – gibt es Noten schon heute nicht mehr. In Schleswig-Holstein konnten Grundschulen bis 2017 wählen, ob sie statt Noten lieber schriftliche Leistungsbeurteilungen vergeben wollen, dann aber wurden im Regelfall wieder verbindliche Noten ab der dritten Klasse eingeführt. Noten seien ein gutes Rückmeldesystem für Eltern und Schüler, heißt es aus dem Bildungsministerium. Es komme nicht selten vor, dass diese nachfragen, in welche Note sich eine bestimmte Formulierung übersetzen lässt.
Das Bildungsbarometer 2018 des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt: Schülerinnen und Schüler selbst wollen Noten. 62 Prozent der befragten Jugendlichen sprachen sich gegen die Abschaffung aus. „Es hat mich erstaunt, wie stark die Jugendlichen – genau wie die Erwachsenen – für ein leistungsorientiertes Schulsystem plädieren“, sagte der Bildungsökonom Ludger Wößmann im Interview mit der „Zeit“.
Wer sagt, dass schriftliche Beurteilungen so viel besser als Noten sind?
Ja, beim Übertritt aufs Gymnasium spielen Noten oft eine wichtige Rolle. Und dass im deutschen Schulsystem zu früh sortiert wird, stimmt sicher auch. Eine zwangsweise Besserung muss eine schriftliche Leistungsbeurteilung aber nicht bringen. Denn wer sagt, dass Entscheidungsträger diese nicht automatisch ins einfachere Ziffernnoten-System übersetzen? Personaler wissen schon heute, dass eine Floskel wie „war im Allgemeinen engagiert“ bedeutet, dass der Kandidat in seinem Job in seiner alten Firma wenig erfolgreich war. Nicht ausgeschlossen, dass Pädagoginnen und Pädagogen für Leistungsbeurteilungen ähnlich floskelhafte Textbausteine verwenden.
Lieber sollten wir über den Numerus Clausus diskutieren
Ist es nun gerecht, dass mein Abischnitt mitentscheidet, ob ich Germanistik studieren darf? Meine Biologienote vorhersagen soll, ob ich später erfolgreich Texte analysiere? Nein, ist es nicht. Aber anstatt die Sinnhaftigkeit von Noten grundsätzlich infrage zu stellen, kann man über den Numerus clausus diskutieren. In Österreich etwa kann sich jede und jeder mit Abiturzeugnis für ein Studium einschreiben. Für Fächer wie Medizin oder Psychologie, in denen es mehr Bewerber als Plätze gibt, werden Aufnahme- bzw. Eignungstests durchgeführt: gleiche Chance für alle, egal welche Noten im Abschlusszeugnis standen.
Und schließlich: Während des Studiums wird man wieder mit Noten konfrontiert sein – und dann hoffentlich nicht zum ersten Mal im Leben.
Abschaffen, denn sie sind ungerecht
meint Ralf Pauli
Dass sich im deutschen Bildungssystem alles um Noten dreht, hat sich selbst mitten in der Corona-Pandemie gezeigt. Obwohl die Wissenschaftsakademie Leopoldina früh empfohlen hatte, bei einer möglichen Wiederaufnahme des Schulbetriebs zuerst an die jüngeren Kinder zu denken (weil diese sich ohne feste Lernstruktur in der Regel schwerer tun als die älteren), hat die Politik nach anderen Kriterien entschieden: Weil ältere Schüler*innen sich vermutlich besser an die Corona-Maßnahmen halten, aber vor allem auch wegen der anstehenden Prüfungen. Also durften – oder mussten – die Abschlussklassen als erste wieder zurück in die Schule.
Die Alternativen zu Schulnoten sind weitaus differenzierter
Dabei muss man gar nicht auf diese virusbedingte Ausnahmesituation schauen, um die Notenfixierung an
Schulen zu kritisieren. Es reicht ein Blick auf die klassischen Ziffernnoten „1“ bis „6“ – und die alternativen Modelle, die heute schon an vielen Grund- und Reformschulen sowie Stadtteilschulen zum Einsatz kommen, darunter Lernstandsgespräche, Kompetenzprotokolle oder sogenannte Indikatorenzeugnisse. Was diese zensurfreien Zeugnisvarianten verbindet: Sie stellen die Stärken und Schwächen eines Schülers viel differenzierter dar, als es eine Note je könnte. Viele Pädagog*innen sind sich einig, dass dies vor allem schlechtere Schüler*innen motiviert, die sonst von der ganzen Klasse mit einer plakativen Zahl als Loser*in abgestempelt würden.
Man muss sich nur den Schulalltag in Deutschland vor Augen führen – Stichwort: überfrachtete Lehrpläne, Bulimielernen, aber auch Mobbing –, um zu verstehen, wie sinnvoll eine Schule ohne Noten für die individuelle Förderung und das soziale Miteinander wäre. Natürlich hieße es für die Eltern Abschied nehmen von eindeutigen Leistungszuschreibungen. Statt „befriedigend“ in Deutsch hätte eine Schülerin dann beispielsweise Stärken in der Rechtschreibung, aber Defizite im Textaufbau. Ein „guter“ Mathe-Schüler wäre hervorragend im geometrischen Verständnis, aber manchmal zu schlampig, um Formeln sauber zu Ende zu rechnen.
Doch eine so differenzierte Leistungsbeurteilung würde ein zentrales Ziel der klassischen Notenvergabe torpedieren: Schüler*innen auf einen Blick miteinander vergleichen zu können. Dabei wissen die Kultusministerien selbst, wie wenig vergleichbar beispielsweise die Abiturnoten sind. Nicht nur, weil die Prüfungsaufgaben teilweise unterschiedlich sind, sondern auch die Fächerkombinationen in den Leistungskursen und deren Gewichtung. Das beeinflusst natürlich auch die Gesamtnote und kann für alle, die studieren wollen, böse Folgen haben.
Noten verstärken die Chancenungleichheit
So haben Abiturient*innen aus Thüringen seit Jahren mit Abstand die besten Abischnitte und auch den höchsten Anteil an Einserschnitten (zuletzt 36,7 Prozent). Und damit klar bessere Karten als Abiturient*innen aus Bayern oder Bremen, in einen zulassungsbeschränkten Studiengang wie Medizin oder Pharmazie reinzukommen. Die 16 einzelnen Bildungssysteme sind so unterschiedlich, dass das Bundesverfassungsgericht beanstanden musste, dass bei der deutschlandweiten Studienplatzvergabe nach Numerus clausus die Abinote nicht mehr das alleinige Kriterium sein darf.
Vor allem aber spricht gegen Schulnoten, dass sie die eh schon große Chancenungerechtigkeit noch verstärken. Beim Übertritt auf das Gymnasium spielen Noten in vielen Bundesländern eine zentrale Rolle – und das begünstigt Kinder aus Akademikerfamilien. Schüler*innen aus sozial schwachen Familien siebt das Bildungssystem oft genau an dieser Stelle aus. Unter anderem, weil die Notenvergabe nicht vor subjektiven Faktoren wie Sympathie oder unterbewussten Vorurteilen schützt. Dann ist ein Modell ohne Noten, das zumindest ein Stück weit vor diesen Fehltritten bewahrt und zudem zum Lernen motiviert, eindeutig die bessere Wahl. Und auch die gerechtere.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.
Collagen: Renke Brandt