Wie sich die Menschen die Tiere ins Haus holten
… und was das mit den Tieren machte

Die Höhle von Lascaux in Frankreich ist voller Tiere: An der Decke galoppieren Pferde, recken Hirsche ihr Geweih dem Betrachter entgegen, schauen Rinder auf sie hinab. Als die Höhlenmalereien 1940 entdeckt wurden, war das eine Sensation. 20.000 Jahre alt sollen sie laut Experten sein, und sie erzählen viel vom frühen Verhältnis der Menschen zu den Tieren. Denn wer Tiere so realistisch darstellen kann, der weiß ganz genau, wie sie sich verhalten, sich bewegen, und vermutlich auch, wann sie fressen oder schlafen.
Die Domestizierung machte das Leben der Menschen sicherer
Rund 8.000 Jahre später ließen die Menschen zunehmend von der Jagd ab und begannen damit, bestimmte Tiere zu halten, sie zu pflegen und nur ausgewählte Exemplare zu schlachten. Damals endete gerade die letzte große Eiszeit, und die Winter im Nahen Osten wurden wärmer und feuchter. Im sogenannten Fruchtbaren Halbmond, einer Gegend, die sich ungefähr von der Nilmündung in Ägypten über die heutigen Staaten Israel und Syrien bis in die Gebirge zwischen Irak und Iran erstreckt, bot das Klima gute Bedingungen zum Leben: Es gab viele Tiere zum Jagen und genug wild wachsende Pflanzen, die man ernten und anbauen konnte. Dort ließen sich Menschen nieder und wechselten vom Jagen und Sammeln zum Ackerbau – und zur Viehzucht. Fast gleichzeitig begann derselbe Prozess in China.
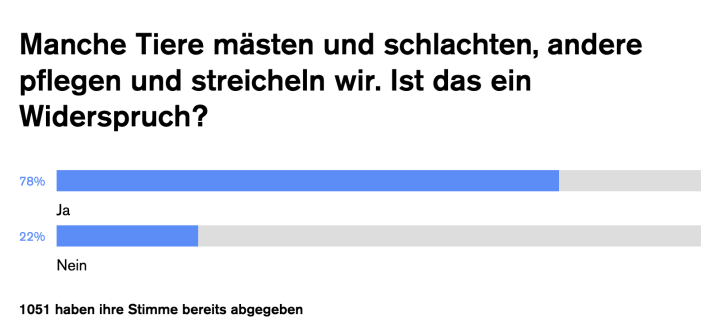
Die Menschen fingen an, Wildziegen, -schweine und -schafe als Hof- und Haustiere zu halten. Es ist nicht klar, wie dieser Prozess begann, aber er hängt eng mit der Entstehung der ersten Siedlungen zusammen, welche die Wildtiere an diesen Orten vertrieben. Die Jäger mussten dadurch immer weiterziehen, um noch Beute zu finden. Jungtiere zu sich zu holen und anzufüttern oder aufzuziehen ist eine denkbare Reaktion darauf. Möglich wäre auch, dass die Menschen der Jungsteinzeit ihre Beutetiere in große, durch Zäune abgesicherte Gehege getrieben haben, um sie dort bequem erlegen zu können – oder um sie von den Äckern fernzuhalten. Archäologische Spuren lassen auf solche Zäune schließen. Vielleicht haben die Menschen festgestellt, dass sich ihre Beute in Gefangenschaft vermehrte – und gingen dann dazu über, die Tiere nicht nur zu jagen, sondern zu pflegen und dafür zu sorgen, dass ihnen andere Raubtiere fernblieben. Und schließlich konnte man die Produkte der Tiere so auch einfacher verarbeiten: Fell und Leder mussten nicht vom Jagdplatz weggeschleppt werden, später kamen Milch und Wolle als Rohstoffe dazu. Alles in allem machte die Domestizierung das Leben sicherer, wenn auch nicht weniger mühsam. Vor allem änderte sie aber das Selbstbild des Menschen: Er war fortan nicht nur Teil der Natur, sondern Herrscher über Pflanzen und Tiere, die er sich untertan machte.
Der viele Tausend Jahre dauernde Prozess der Domestizierung hat sich an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten unabhängig voneinander vollzogen. Für Europa ist der Nahe Osten entscheidend, aber auch in Asien, Afrika und auf den amerikanischen Kontinenten domestizierten die dort lebenden Menschen Tiere: Aus Asien stammen beispielsweise das Huhn und der Wasserbüffel, in Südamerika wurden Lamas und Alpakas gezähmt, Esel kommen ursprünglich aus Afrika, Pferde wurden erstmals in den zentralasiatischen Steppen gezähmt.
Die Nähe zu den Menschen hat die Tiere nicht gerade schlauer gemacht
Als erstes domestiziertes Tier gilt aufgrund von Knochenfunden und Genanalysen der Hund, der sich dem Menschen bereits vor 20.000 bis 40.000 Jahren angeschlossen haben soll. Hunde dienten damals schon als Jagdgefährten und, in schweren Zeiten, als Fleischlieferanten. Darüber, wie die Domestizierung des Hundes genau begann, lässt sich aber nur spekulieren: Wahrscheinlich haben Wölfe in der Nähe von menschlichen Lagern die dort angefallenen Abfälle gefressen oder sind Jagdtrupps gefolgt, um Aas zu erbeuten. Menschen und Hunde waren sich jedenfalls sehr nahe, vielleicht wurden schließlich ein paar weniger scheue Tiere angefüttert, oder ein Jäger brachte Welpen als Mitbringsel in das Lager.
Neben dem Hund hat der Mensch auch früh eine besondere Beziehung zu einem weiteren Tier entwickelt: Die Katze ist ein Beispiel für eine sogenannte Selbstdomestizierung. So passte anscheinend die libysche Falbkatze als Unterart der Wildkatze ihr Verhalten so an, dass Menschen sie bei sich behalten wollten. Wildkatzen könnte es in menschliche Siedlungen gezogen haben, weil sie dort relativ einfach von den Abfällen und Essensresten der Bewohner leben konnten. Zudem jagten sie Ungeziefer wie Ratten und Mäuse, was sie für den Menschen nützlich machte. Schließlich entwickelten Katzen Verhaltensweisen, die ihre wilden Artgenossen nicht aufweisen: So miauen normalerweise nur Jungkatzen in Gegenwart ihrer Mütter. Hauskatzen aber zeigen dieses Verhalten auch noch im Erwachsenenalter, wohl weil es der Kommunikation mit dem Menschen hilft.
Als Auswirkung der Domestizierung verhalten sich Tiere auch als Erwachsene wie Jungtiere und haben beispielsweise größere Augen und Schlappohren – Merkmale des sogenannten Kindchenschemas. Das empfinden Menschen oft als niedlich, zudem ruft es den Beschützerinstinkt wach, was diesen Tieren einen evolutionären Vorteil verschafft. Außerdem sind domestizierte Tiere meist kleiner als ihre wilden Verwandten und haben eine geringere Hirnmasse. Man könnte also sagen: Die Nähe zu den Menschen hat die Tiere jung gehalten, aber nicht gerade schlauer gemacht.
Titelbild: Daniel Gebhart de Koekkoek
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.