Ich kaufe ein .gay
Dreht das Netz am Rad? Neue Endungen sollten neue Vielfalt bringen – und brachten Streit. Denn am Zuge ist nun doch hauptsächlich wieder, wer mehr zahlen kann
Das war schon seltsam, dass Ländergrenzen im eigentlich grenzenlosen World Wide Web so lange noch so wichtig waren. Jedenfalls für die Endungen der Internetadressen waren sie das: Eine deutschsprachige Internetseite endete meist auf „.de“, eine französische auf „.fr“ und eine polnische auf „.pl“. Alternativ gab es noch allgemeine Endungen wie „.com“ oder „.org“. Damit ist es mittlerweile vorbei. Seit Frühjahr 2013 sind Hunderte digitale Schubladen hinzugekommen: Unternehmen, Blogs oder Shops aus der deutschen Hauptstadt etwa steht die Endung „.berlin“ zur Verfügung. Auch im Angebot: „.bayern“, „.reise“ oder „.jetzt“. Spaßvögel können sich eine Webseite unter „.lol“ einrichten, Schlauberger ihren Blog auf „.guru“ oder „.expert“ enden lassen.
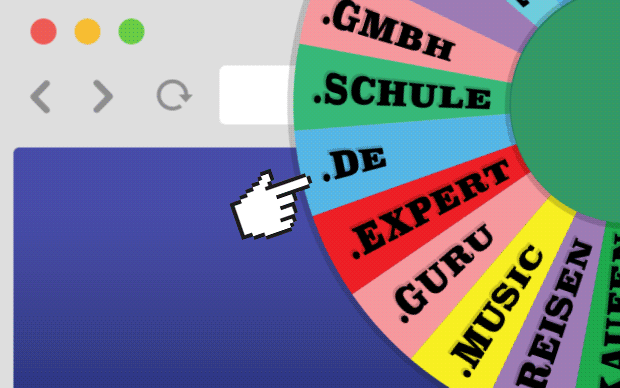
Herrin der neuen Endungen ist die US-amerikanische Organisation ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), eine Art globale Internetbehörde. Die verwaltet eine lange Liste. In der stehen alle „Top Level Domains“, wie die Endungen in der Sprache von Nerds und Domain-Unternehmern heißen.
Für 185.000 US-Dollar konnte sich im Frühjahr 2012 jeder um eine frei gewählte Endung bewerben. Die neuen Top Level Domains versprechen ein interessantes neues Geschäft. Man könnte sie als große digitale Landstücke bezeichnen. Die neuen Inhaber der Internetendungen vermieten über Zwischenhändler einzelne Parzellen darauf, so dass sich dort Webshops, Firmenseiten oder Blogs ansiedeln können. Für jede konkrete Webadresse kassieren die Betreiber der Endungen dann eine jährliche Gebühr. Und je nach Fall können das 20 Euro oder auch mal 200 sein.
Seit Herbst 2013 werden die neuen Endungen sukzessive der ICANN-Liste hinzugefügt. Und das verläuft alles andere als harmonisch. Bei einigen Endungen streiten sich bis heute noch mehrere Interessenten um das Recht, sie zu betreiben und zu vermarkten, etwa bei „.music“. Und auch sonst gibt es beim großen Verteilungskampf der ICANN eine Menge Konfliktstoff.
Die mit den dicken Finanzpolstern setzen sich durch
Ob das globale Geschäft mit den neuen Endungen auch zu globaler Vielfalt von URLs führen wird, daran bestehen Zweifel. Bisher konzentriert sich die Nachfrage auf wenige Länder. Von den ursprünglich 1.930 Bewerbungen kamen 45 Prozent aus den USA, nur 1,5 Prozent aus ganz Lateinamerika und weniger als 1 Prozent aus Afrika. Ein wichtiger Grund: Die weltweit einheitliche Bewerbungsgebühr von 185.000 Dollar war für viele westliche Firmen kein Hinderungsgrund, für viele Unternehmen in weniger wohlhabenden Ländern hingegen stellte sie offenkundig eine zu hohe Hürde dar.
Zudem läuft das globale Geschäft über wenige sehr große Firmen – die Betreiber der Endungen. Das Reich des Top-Level-Domain-Giganten „Donuts Inc.“ etwa umfasst mehr als 200 Endungen, darunter auch „.schule“, „.reise“, „.reisen“ und „.gmbh“. Auch Google und Amazon gehören zu den wichtigen Playern auf dem Markt der neuen Endungen und bauen damit ihre Macht im Netz weiter aus. Allein Google hatte sich für 100 neue Endungen beworben. Wenn eine Endung zwischen mehreren Bewerbern versteigert wird, kann sich der Konzern aufgrund seines dicken Finanzpolsters leicht durchsetzen. Für „.app“ beispielsweise zahlte Google ganze 25 Millionen US-Dollar, shop.de ging im Januar diesen Jahres für 41,5 Millionen Dollar nach Japan.
Empörte Communitys und privilegierte Marken
In der Zivilgesellschaft rumort es derweil: Endungen, für die es mehrere Interessenten gibt, werden normalerweise an den Meistbietenden versteigert – kleinere Initiativen gehen dabei oft leer aus. Damit nicht immer das dickste Portemonnaie gewinnt, wurde als Gegenmodell die Idee von „Community“-Endungen eingeführt, für die andere Bedingungen und andere Regeln gelten.
Sie richten sich an eine bestimmte, klar definierte Gruppe – seien es Taxifahrer, Radiomacher oder Schwule, Lesben und Transpersonen. Um zu belegen, dass die potenziellen Betreiber der Endung diese Community repräsentieren, müssen sie die schriftliche Unterstützung von relevanten Organisationen und Interessenverbänden vorweisen können. Zudem sollen klare Regularien dafür sorgen, dass sich tatsächlich nur Angehörige der jeweiligen Gruppe registrieren. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, bekommen die Bewerber mit dem Community-Konzept automatisch den Zuschlag vor anderen Interessenten.
Geld schlägt Konzept
Der Haken: Der „Community-Status“ wird ihnen von einem hinter verschlossenen Türen arbeitenden ICANN-Gremium zuerkannt – oder eben auch nicht. In den meisten Fällen hat es seine Zustimmung bisher verweigert. Die schöne Idee namens Community-Endungen existiert also eher in der Theorie als in der Praxis. Für besondere Empörung sorgte das beim Community-Konzept für „.gay“, hinter dem weltweit rund 100 Szene-Organisationen standen. Obwohl nach Meinung der meisten Beobachter alle Voraussetzungen lehrbuchhaft erfüllt waren, sagte das ICANN-Gremium „Nein“. Die Leute hinter dem Community-Konzept müssen sich jetzt doch einer Auktion stellen und dabei mit großen Domain-Konzernen konkurrieren.
Einiges deutet darauf hin, dass am Ende doch wieder gilt: Geld schlägt Konzept. Dass die ganze Idee hinter den Community-Endungen bereits auf dem besten Wege ist, obsolet zu werden, räumte unlängst Olivier Crépin-Leblond ein. Der Interessenvertreter der Zivilgesellschaft und der einzelnen Internet-Nuzer bei der ICANN sagte in einem Interview: „Dann werden alle Endungen in Auktionen an diejenigen gehen, die am meisten zahlen. Und Communitys haben tendenziell weniger Geld als multinationale Bewerber.“
Streit gibt es auch um die Sondergruppe der Marken-Endungen. Auf denen darf nicht jeder eine Webseite registrieren, stattdessen sind die Endungen Hoheitsgebiet der jeweiligen Markeninhaber. Bei „.edeka“, „.google“ oder „.bmw“ ist das kaum problematisch, anders sieht es aus, wenn die Marken gleichzeitig Begriffe des allgemeinen Sprachschatzes sind. Der Süßwarenkonzern Ferrero hatte sich um „.kinder“ beworben, und zwar als Marken-Endung – passend zu den Konzernprodukten wie „Kinder-Riegel“ oder „Kinder-Schokolade“. Die ICANN gab dem Wunsch von Ferrero nach, trotz Protesten des Deutschen Kinderschutzbunds und des Bundesfamilienministeriums.
Stefan Mey, freier Journalist, stammt aus Halle/Saale in Sachsen-Anhalt. Schön an den neuen Endungen findet er, dass so zumindest im Internet die Ländergrenzen irrelevanter werden.