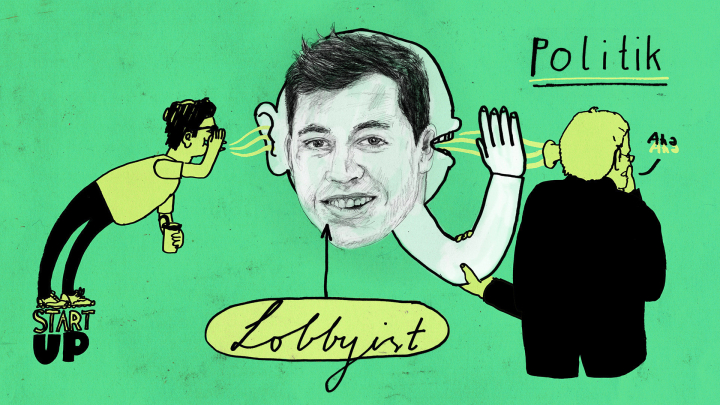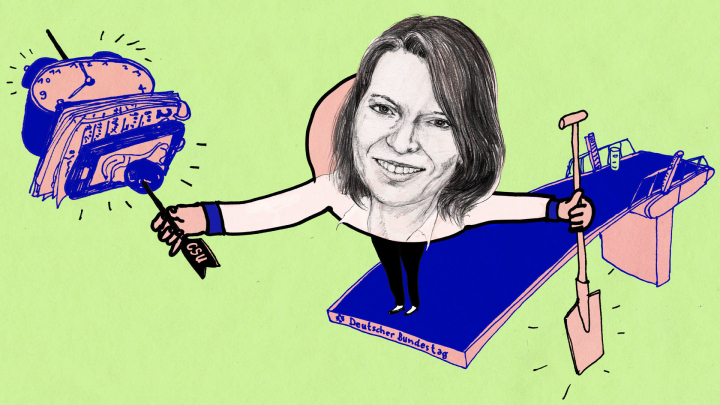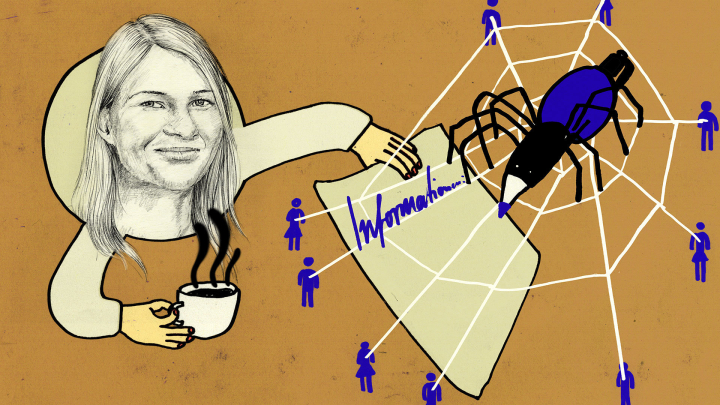Flyern statt feiern
Anna Kryszan studiert und macht nebenbei Wahlkampf. Sie glaubt: Das ist eine gute Schule fürs Leben – und nimmt hin, dass sie dabei auch mal verbal eins auf die Fresse kriegt

Vor einem Jahr bin ich in den Landesvorstand der Julis gewählt worden. Wir sind relativ unabhängig von der FDP, aber da wir ja nicht auf dem Wahlzettel stehen, machen wir im Grunde natürlich auch Wahlkampf für unsere Mutterpartei. Jetzt im Bundestagswahlkampf bin ich Chefin der sogenannten Ausführungstruppe. Die Fragen, die ich mir in dieser Position stellen muss: Was machen wir im Wahlkampf – und was brauchen wir dafür?
Die Arbeit beinhaltet vor allem viele typische Orga-Aufgaben. Vor dem Christopher Street Day zum Beispiel, wo wir einen Wagen hatten, musste Deko organisiert werden, Leute mussten angemeldet werden und so weiter. Ich schreibe tausend E-Mails.
„Das Privatleben leidet auf jeden Fall“
Man würde denken, dass diese Arbeit ziemlich einfach ist und sich nebenbei erledigen lässt, aber sie ist doch ziemlich, ziemlich zeitaufwendig. Jetzt im Wahlkampf nimmt dieser Orga-Kram bestimmt 20 Stunden pro Woche ein. Die muss man aufbringen und zudem sehr gewissenhaft arbeiten. Das Privatleben leidet da auf jeden Fall ein bisschen.
Wie werde ich professionelle Wahlkämpferin?
Auch wenn es mittlerweile Studiengänge gibt, die sich gezielt mit politischer Kommunikation befassen: Viele Wahlkampfmanager haben ganz klassisch Politik- oder Sozialwissenschaften studiert. Von Vorteil ist Erfahrung in Journalismus und Werbung – Texte schreiben, Videos produzieren und Grafiken entwerfen zu können, das ist auch im Wahlkampf gefragt. Der Einstieg in den Job ist von Partei zu Partei unterschiedlich und hängt auch davon ab, ob man auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene tätig sein will. Grundsätzlich aber gilt: Wer Kontakte hat, schon in der Bundesgeschäftsstelle einer Partei oder in einem Abgeordnetenbüro gearbeitet hat, hat sicher keine schlechten Karten. Übrigens: Die Wahlkampfteams werden in der Regel gut ein Jahr vor der Wahl aufgestockt – schrumpfen danach aber auch wieder.
Und dabei ist das alles auch noch ehrenamtlich. Unser Wahlkampfteam war schon ein bisschen traurig, als wir im Winter Unterschriften für die Offenhaltung des Flughafens Tegel gesammelt haben und alle Leute dachten, wir würden dafür bezahlt. Schön wär’s! Wir haben halt Bock, politisch was mitzugestalten, weil wir die liberale Idee gut finden.
Ende August geht es richtig los mit den gezielten Wahlkampfaktionen, und ich bin auch auf der Straße mit dabei. Ich flyere gerne, aber natürlich kommt es immer drauf an, wo man mit seinem Stand platziert ist. An manchen Orten macht die Arbeit viel Spaß: An der Schlossstraße (Einkaufsstraße im Berlin Steglitz Zehlendorf, Anm. d. Red.) sind die Leute ziemlich nett. Wir mussten aber auch schon mal die Polizei rufen, als wir einen Stand an der Warschauer Straße (Partymeile in Berlin-Friedrichshain, Anm. d. Red.) aufgestellt hatten.
Als Wahlkampfhelferin will man Leute überzeugen. Manche von uns sprechen wenige Leute an, aber unterhalten sich lange mit ihnen. Andere versuchen, einfach möglichst viele Flyer unter die Leute zu bringen. Ich bin mir noch unsicher, welche die bessere Methode ist.
So oder so finde ich es am besten, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das eine Mal wird man beschimpft, das andere Mal dafür gelobt, dass man sich für etwas einsetzt. Manchmal werde ich mit guten Gesprächen und Zustimmung belohnt, manchmal kriege ich verbal eins auf die Fresse.
Was verdiene ich da?
Da die Stellen oft mit Freiberuflern besetzt werden, hängt das nicht zuletzt vom individuellen Verhandlungsgeschick und der Berufserfahrung ab. Allerdings orientiert sich die Bezahlung in der Regel grob am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, und da kann Insidern zufolge – Beispiel Wahlkampfleiter auf Bundesebene – die Besoldung eines Abteilungsleiters einer mittelgroßen Behörde als Anhaltspunkt dienen (liegt aktuell bei 6.000 bis 8.000 Euro monatlich). Gerade bei den großen Parteien könne die Bezahlung aber durchaus höher ausfallen, sagt der Wahlkampfmanager, der uns für diesen Infokasten Rede und Antwort stand. Er hat schon einmal einen Europawahlkampf geleitet und möchte lieber anonym bleiben.
Im Wahlkampf mitzuhelfen ist eine gute Schule fürs Leben. Zum Beispiel lernt man, ein bisschen frecher und lockerer zu sein. Alle von einem Wahlprogramm zu überzeugen? Das funktioniert eh nicht. Ich versuche immer, so höflich wie möglich zu sein – schließlich geht es um Menschen –, manchen scheint Anstand aber auch komplett egal zu sein. Mir wurde erzählt, dass die Julis nach der desaströsen Bundestagswahl 2013 von Passanten zum Teil mit Gegenständen beschmissen wurden. Aber jetzt ist die Stimmung uns gegenüber relativ wohlwollend.
„Die Arbeit braucht schon ein bisschen Mut“
Die Arbeit braucht schon ein bisschen Mut – fremde Leute auf der Straße anzusprechen kostet Überwindung. Außerdem ist ein gewisses Level an Ruhe ganz gut, schließlich läuft nicht alles immer so, wie man es plant. Damit muss man lernen umzugehen.
Wer auch im Wahlkampf mithelfen will, wendet sich am besten an die Jugendorganisation der jeweiligen Partei. Die sind alle relativ niederschwellig organisiert, und Neumitglieder werden schnell eingebunden – natürlich besonders gern im Wahlkampf. Einfach mal im Netz oder vor Ort vorbeischauen.
Illustration: Frank Höhne