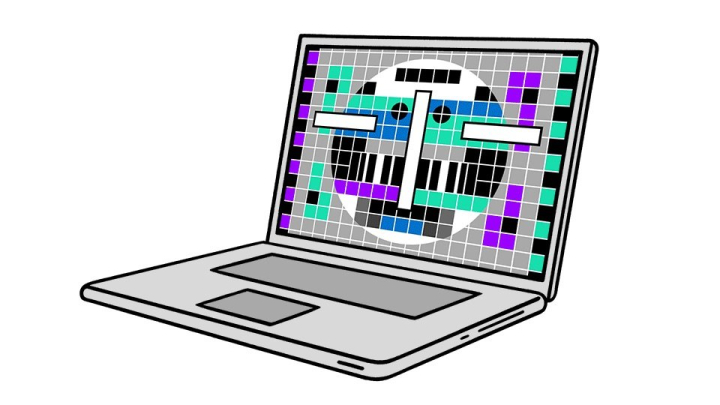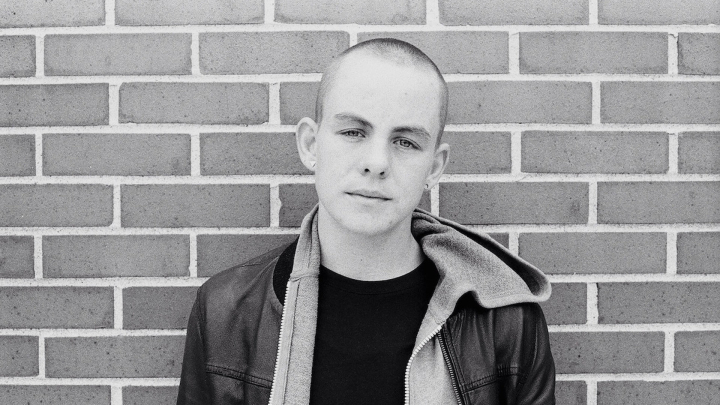Fußball für alle?
Saudische Frauen dürfen heute zum ersten Mal mit zu einem Fußballspiel der Profiliga. Der Kronprinz zeigt damit aber nicht nur guten Willen

Frauen in Saudi-Arabien dürfen zum ersten Mal seit der Staatsgründung ein Fußballspiel im Stadion besuchen. Nicht einfach so, sondern unter bestimmten Auflagen: Frauen dürfen drei ausgewählte Spiele in Begleitung ihrer Männer und nur in den dafür bereitgemachten „Familien-Blocks“ besuchen. Das heutige Spiel der ersten saudischen Liga findet zwischen den Profivereinen Al-Ahli und Al-Batin statt und wird in Dschidda ausgetragen. In diesem Monat dürfen zwei weitere Spiele in der Hauptstadt Riad und in Dammam von Frauen besucht werden. Welche das sein werden, ist noch nicht bekannt.
Bisher hat die saudische Führung Frauen nur wenige Rechte im öffentlichen Leben eingeräumt. Das scheint sich langsam zu ändern. Am deutlichsten wird die Veränderung an einem Dekret, das es Frauen ab Juni 2018 erlaubt, selbst Auto zu fahren.
Auch wenn es nicht die Welt bedeutet, so ist dies ein kleiner Schritt in eine neue Richtung
Dagegen mag der Besuch im Stadion erst mal lächerlich klingen. Aber: Fußball ist in Saudi-Arabien ein großes Thema. Dass Frauen nun auch ein bisschen etwas davon haben dürfen, ist Teil der kleinschrittigen Veränderungen im Land. In Saudi-Arabien gelten die strengen Regeln des wahhabitischen Islam.
Die Erlaubnis zum Autofahren ist auch ökonomisches Kalkül. Laut der „Vision 2030“ soll der Anteil der arbeitenden Frauen im Land bis 2030 auf etwa 30 Prozent steigen. Der ambitionierte Entwicklungsplan geht vor allem auf den progressiven Kronprinzen Mohammed bin Salman (MBS) zurück. Er kündigt an, sein Land unabhängiger vom Öl zu machen und den strikten Wahhabismus weniger im Alltag dominieren zu lassen. Noch stammen fast 90 Prozent der Einnahmen aus dem Ölgeschäft, und die religiöse Elite hat viel zu sagen.
International erregt MBS sowohl mit seiner Bereitschaft zur Modernisierung Aufmerksamkeit als auch mit einer großen Verhaftungswelle im eigenen Königshaus. Im vergangenen Jahr ließ er Dutzende Prinzen und Minister im Ritz-Carlton festgesetzt – offiziell wegen Korruptionsverdacht. Dabei geht es wohl mehr um Machtkämpfe innerhalb der Regierung, denn nicht alle finden den Wandel durch MBS gut.
Für viele junge Saudis erscheint MBS mit seiner Vision 2030 als einer, der ihre Interessen versteht. Darunter fällt dann wohl auch die Idee, dass Frauen nun ab und zu mal mit ins Stadion dürfen.
Foto: REUTERS/Faisal Al Nasser