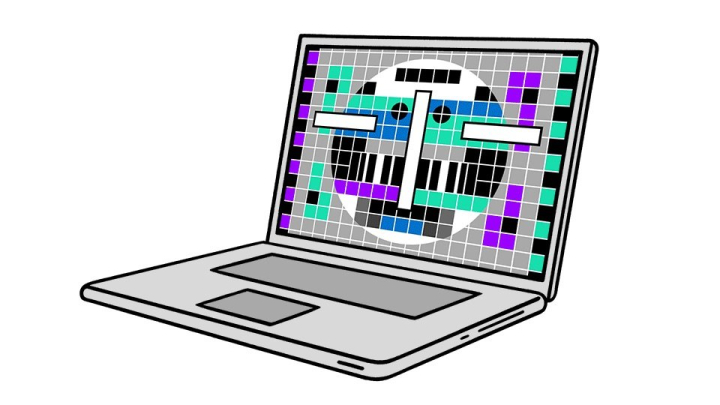„Mit 60 wird man schon als halb tot angesehen“
Über 100 wütende „Omas gegen Rechts“ marschieren in Österreich bei Demos mit. Eine Mitbegründerin der Protestbewegung erzählt, warum sie die Jugend dringend aufrütteln will

fluter.de: Seit Anfang des Jahres sind die lautstarken „Omas gegen Rechts“ bei Protesten nicht mehr wegzudenken. Wer oder was ist Ihrer Meinung nach denn genau dieses „Rechts“?
Monika Salzer: Das aktuelle politische Klima in Österreich im Allgemeinen und unsere neue Bundesregierung, bestehend aus der konservativen ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ, im Speziellen. Momentan wird in der Öffentlichkeit viel Hass gepredigt und gegen alles „Fremde“ gehetzt. Wir als eine Generation, die nach dem Krieg geboren wurde und Österreich mit aufgebaut hat, wollen das nicht zulassen. Auf dem Spiel steht vieles, das in unserer Jugend extrem wertvoll war, zum Beispiel der Glaube an Freiheit, Demokratie und den Rechtsstaat.
„Wir haben dieses Land und Europa mit aufgebaut, wir haben das Recht, uns auch weiterhin einzumischen“
Im Manifest der „Omas gegen Rechts“ klingt an: Viele von Ihnen kämpfen nicht erst seit gerade eben, sondern schon ein Leben lang. Wofür?
Wir sind immerhin die 1968er-Generation! In den 60er-Jahren sind wir auf die Straße gegangen und haben Gleichberechtigung gefordert. Wir haben unseren Kindern Humanismus mitgegeben, haben sie zu Toleranz und Solidarität erzogen. Was sich momentan in manchen österreichischen Medien und in politischen Debatten abspielt, zeugt nur noch von einer ethischen Katastrophe.
In Ihrer Hymne „Omas, Omas, uns braucht das ganze Land“ singen Sie: „Wacht auf, ihr jungen Frauen, wir helfen euch dabei. Es ist nicht mehr zu trauen dieser Menschensklaverei“. Was glauben Sie zu erkennen, das wir Jungen nicht bemerken?
Was prinzipiell übersehen wird, zum Teil auch von den grünen Parteien, den Sozialisten und der Wählerschaft, die man gern als „links“ bezeichnet, ist, dass wir unsere Umwelt und uns selbst ausbeuten. Und zwar so sehr, dass unsere Jugend später ein Problem haben wird. Viele sehen nicht, dass unser neoliberales Wirtschaftssystem gezähmt werden muss. Man kann damit die Welt an die Wand fahren! So viele Menschen erkennen nicht, dass es nicht um Details geht, sondern um Grundsätze. Es wäre längst eine ehrliche Wirtschaftskritik angesagt.

Warum glauben Sie, dass gerade wir Jungen gesellschaftliche Missstände übersehen?
Weil ihr es nicht anders kennt. Außerdem wird man als Jugendlicher und junger Erwachsener ja oft noch von den Eltern finanziell unterstützt und hat den Eindruck: Ist eh alles okay. Wenn man dann aber in die Arbeitswelt einsteigt und mit dem massiven Druck des Systems konfrontiert wird, ändert sich das schnell. Viele erfahren, was Karl Marx als eine Entfremdung des Menschen von der Arbeitswelt und sich selber beschrieben hat. An der Generation meiner Kinder bemerke ich, auch als Psychotherapeutin, dass ein wahnsinniger Druck auf ihnen lastet. Wenn eine halbe Generation an einem Burn-out leidet, ist das eine ernst zu nehmende Sache.
Ist die Gefahr eines Burn-outs Ihrer Meinung nach denn heute so viel höher als vor 50 Jahren?
„Ich habe das Gefühl, dass es den Jungen heute viel schlechter geht als uns damals“
Ja, viel! Heute herrscht ein ganz anderes Tempo, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Früher war das Leben für junge Erwachsene viel bedächtiger und voller Hoffnung. Wir haben damals im Paradies gelebt. Wir wussten: Jeder kriegt einen Job. Ich habe das Gefühl, dass es den Jungen heute viel schlechter geht als uns damals.
Dass sich die „Omas gegen Rechts“ im November via Facebook zusammengefunden haben, widerspricht dem Klischee der Großmutter, die den Einschaltknopf am Computer nicht findet.
Ja, das ist immer lustig. Ich mein: Wir haben in den letzten 20 Jahren ja auch nicht geschlafen.
Die pensionierte evangelische Pfarrerin und Psychotherapeutin Monika Salzer (70) startete zusammen mit der Journalistin Susanne Scholl (69) Mitte November in Wien die Protestbewegung „Omas gegen Rechts“. In mehreren Städten, auch in Deutschland, formieren sich bereits Ableger
Mit welchen anderen Vorurteilen wollen Sie aufräumen?
Dass Alte nichts mehr zu sagen haben. Mit 60 wird man heute ja schon als halb tot angesehen. Wir haben dieses Land und Europa mit aufgebaut, wir haben das Recht, uns auch weiterhin einzumischen.
Der Chef der Salzburger Identitären kommentierte Ihren Aktivismus mit dem Tweet: „Wenn man länger lebt, als man nützlich ist und vor lauter Feminismus nie Stricken lernte.“
Dieser Mensch ist einfach lächerlich, und sein Kommentar geht an uns vorbei. Tatsächlich hat er uns nur noch bekannter gemacht. Wir wurden auch sofort von vielen verteidigt.
Und was ist eigentlich mit den Opas?
Bei uns sind die Opas integriert. Selbstbewusste Opas pochen nicht darauf, Opa genannt zu werden, und marschieren bei uns mit. Die sagen: „Wir sind auch Omas.“
Fotos: Fabian Weiss
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.