„Ein Papa ist immer irgendwie optional“
Warum ist Care-Arbeit immer noch so ungleich verteilt? Ein Gespräch mit den Autor*innen Jacinta Nandi und Jochen König über das Hausfrauen- und Hausmanndasein

Jacinta Nandi ist Kolumnistin, Lesebühnenautorin und verstand sich lange als Vorzeigefeministin. Zurzeit ist sie Hausfrau. Und beides zu sein, Feministin und Hausfrau, das klingt für viele Menschen nach einem Widerspruch. Aber ist es das? Das fragt Jacinta Nandi in ihrem neuen Buch „Die schlechteste Hausfrau der Welt“ (erschienen bei Edition Nautilus). Für die Familie kürzerzutreten, dafür entscheiden sich nach wie vor mehr Frauen als Männer. In jeder vierten Paarfamilie bleibt die Frau ganz zu Hause. Außerdem arbeiten nur 6,9 Prozent der erwerbstätigen Väter mit Kindern unter sechs Jahren in Teilzeit, aber rund zwei Drittel der Mütter. Nandi bezweifelt, dass es sich dabei immer um eine komplett freie Entscheidung handelt. Aus ihrer Sicht weigern sich viele Männer einfach, ihren Teil der Care-Arbeit zu übernehmen, und siedeln Aufgaben wie Putzen, Spielplatzbesuche oder die Betreuung kranker Kinder wie selbstverständlich im Verantwortungsbereich der Frau an. In ihrem neuen Buch erzählt sie deshalb mal wütend, mal derb und meistens sehr lustig, warum für sie das Thema Hausarbeit politisch ist.
Die Männer in ihrem Buch kommen nicht gerade gut weg: Fürs Putzen sind sie sich zu schade, und das Wechselmodell, bei dem die Kinder halb beim Vater, halb bei der Mutter leben, wollen sie nur, um Geld zu sparen. Dass das nicht auf alle zutrifft, weiß Nandi auch. Spätestens seit sie Jochen auf einer WG-Party getroffen hat: Jochen König war im ersten Lebensjahr seiner älteren Tochter überwiegend allein zu Hause. Aktuell teilt er sich die Care-Arbeit für seine beiden Töchter zu etwa gleichen Teilen mit deren Müttern, von denen er getrennt lebt. Mit der Mutter seiner ersten Tochter war er ein Paar, seine zweite Tochter hat er gemeinsam mit zwei Müttern auf Basis einer Freundschaft bekommen. Über sein Familienmodell hat er zwei Bücher geschrieben: „Fritzi und ich“ und „Mama, Papa, Kind? Von Singles, Co-Eltern und anderen Familien“. Königs Kinder sind mittlerweile fünf und elf. Nandi hat zwei Söhne aus zwei Beziehungen, der kleine ist drei und der große 15 Jahre alt.
fluter.de: Jacinta, in deinem Buch schilderst du, wie dein Freund nach der Geburt deines Kindes erwartet, dass du die komplette Hausarbeit übernimmst. Du schreibst dazu: „Das Ungewöhnliche an meiner Situation ist nur die Tatsache, dass mein Freund zugibt, dass er nicht vorhat mitzumachen. In vielen deutschen Haushalten existiert der Mythos von einer 50/50-Mitarbeit.“ Ist 50/50 denn wirklich so ein Mythos?
Jochen König: Sobald die Leute einen Vater mit Kind auf dem Spielplatz sehen, denken sie, dass alles gerecht aufgeteilt ist. Viele Väter gehen heute auch in Elternzeit und übernehmen einen Teil der Care-Arbeit. Die Hauptverantwortung liegt aber weiterhin klar bei der Mutter. Und warum sollten Väter daran auch etwas ändern? Die Vaterrolle ist eine sehr komfortable: Man erlebt ein Kind beim Großwerden und kann eine ganz tolle und enge Beziehung zu ihm haben – ohne die ganze Arbeit machen und zurückstecken zu müssen. Bei mir gab es diese Rollenverteilung ja auch, nur eben andersrum. Meine große Tochter hat früher immer Mama zu mir gesagt. Es war eben das Wort, das sie mit dieser Rolle verbunden hat. Alle anderen Kinder in der Kita sprachen ständig von ihrer Mama, und da bei uns ich es war, der diese Rolle eingenommen hat, war ich eben Mama. Das zeigt, finde ich, recht deutlich, wie klar hier die Geschlechterzuschreibung immer noch ist.

Jacinta Nandi: Wir haben so niedrige Erwartungen an die Papas. Das kotzt mich wirklich an. Ich bin vor einiger Zeit mit dem Vater meines kleinen Sohnes Zug gefahren. Ich habe ihn gebeten, die Windeln zu wechseln, und dann kam gleich so eine Omi auf uns zu und hat mich beglückwünscht, wie toll das doch sei, dass ein Vater so etwas macht. Klar hat sich viel verändert, seit diese Frau jung war. Aber trotzdem dachte ich mir: Windeln wechseln – das sollte doch so normal sein! Es wird alles besser, mein älterer Sohn hat schon so viel mehr von seinem Papa, als ich von meinem hatte. Aber wenn mein Sohn krank war, galt dann doch: „Ein Kind braucht seine Mutter.“ Manchmal denke ich, ein Papa ist immer irgendwie optional, ein bisschen Luxus.
Jochen König: Väter helfen mit, machen ein bisschen was, aber ganz klar weniger als die Hälfte. Und gleichzeitig gibt es dieses Abfeiern der „neuen Väter“. Das nervt mich auch total.
Jacinta, in deinem Buch schreibst du, Hausfrauen würden mitunter dafür verachtet, dass die Arbeit, die sie machen, keine Lohnarbeit ist. Ist ein Grund für das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern also auch unser kapitalistisches System? Im Sinne von „das Geld entscheidet“?
Jacinta Nandi: Ja, mein Ex-Freund und ich haben vor der Geburt unseres Kindes auch nie darüber gesprochen, wie wir das finanziell regeln wollen. Ich war dumm, oder? Solange ich nichts verdiente, war klar, dass ich für den Haushalt zuständig bin.
Du warst dumm? Das würde ja bedeuten, wer zu Hause bei den Kindern bleibt und kein Geld verdient, ist selbst schuld.
Jacinta Nandi: Stimmt. Mütter wurden ja schon immer von allen Seiten kritisiert: Wenn sie ihr Kind zu früh oder zu lange in die Betreuung geben, sind sie schlechte Mütter. Wenn ihr Mann verdient und sie zu Hause bleiben, sind sie Schmarotzer. Und wenn es keinen Mann gibt und sie nicht arbeiten gehen, sind sie Sozialschmarotzer.
„Zu einem Mann, der wenige Wochen nach der Geburt seines Kindes wieder voll arbeiten geht, sollten die Kolleg*innen sagen: ‚Du nutzt gerade jemanden aus‘.“
Jochen König: Ich finde, in deinem Buch, Jacinta, kommt schön raus, dass es nicht unbedingt die Hausarbeit an sich ist, die so schrecklich ist, sondern die Verhältnisse, in denen diese Hausarbeit gemacht werden muss: Unser kapitalistisches System honoriert Care-Arbeit einfach nicht genug. Ich kann zu Hause so viel arbeiten, wie ich will, am Ende des Monats habe ich trotzdem kein Geld auf dem Konto – und später keine Rente.
Was wäre die Lösung? Der Mann überweist der Frau, die zu Hause bleibt, 50 Prozent seines Gehalts?
Jacinta Nandi: Keiner weiß genau, wie Paare das regeln. Die Deutschen sprechen ja nicht über Geld, das finde ich echt interessant. Es gibt so eine Scheingleichberechtigung in Deutschland. Die meisten Mütter arbeiten entweder in Teilzeit oder sind ganz zu Hause. Diese Frauen sind vermutlich zu großen Teilen abhängig vom Geld ihrer Männer.
Jochen König: Es müsste einfach gesellschaftlich verpönt sein, zu viel Lohn- und zu wenig Care-Arbeit zu machen. Zu einem Mann, der wenige Wochen nach der Geburt seines Kindes wieder voll arbeiten geht, sollten die Kolleg*innen sagen: „Okay, in dem Moment, wo du hier bist, nutzt du gerade jemand anders aus, der deine Scheiße zu Hause wegmacht – oder eben die Scheiße deines Kindes.“
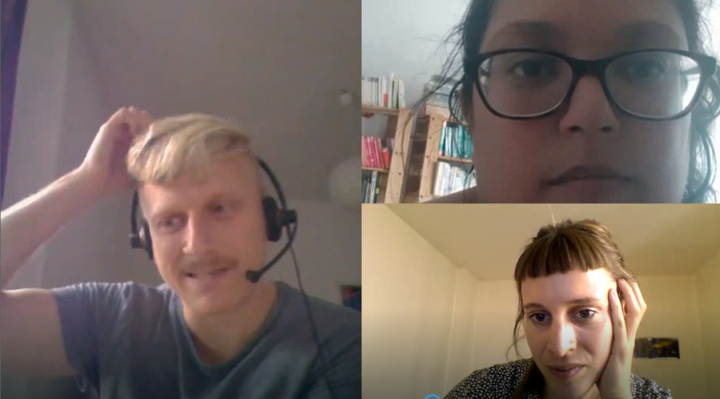
Fotos: Nikita Teryoshin
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.

