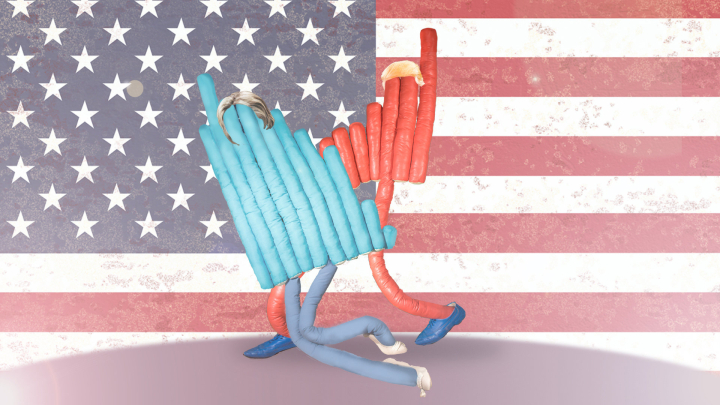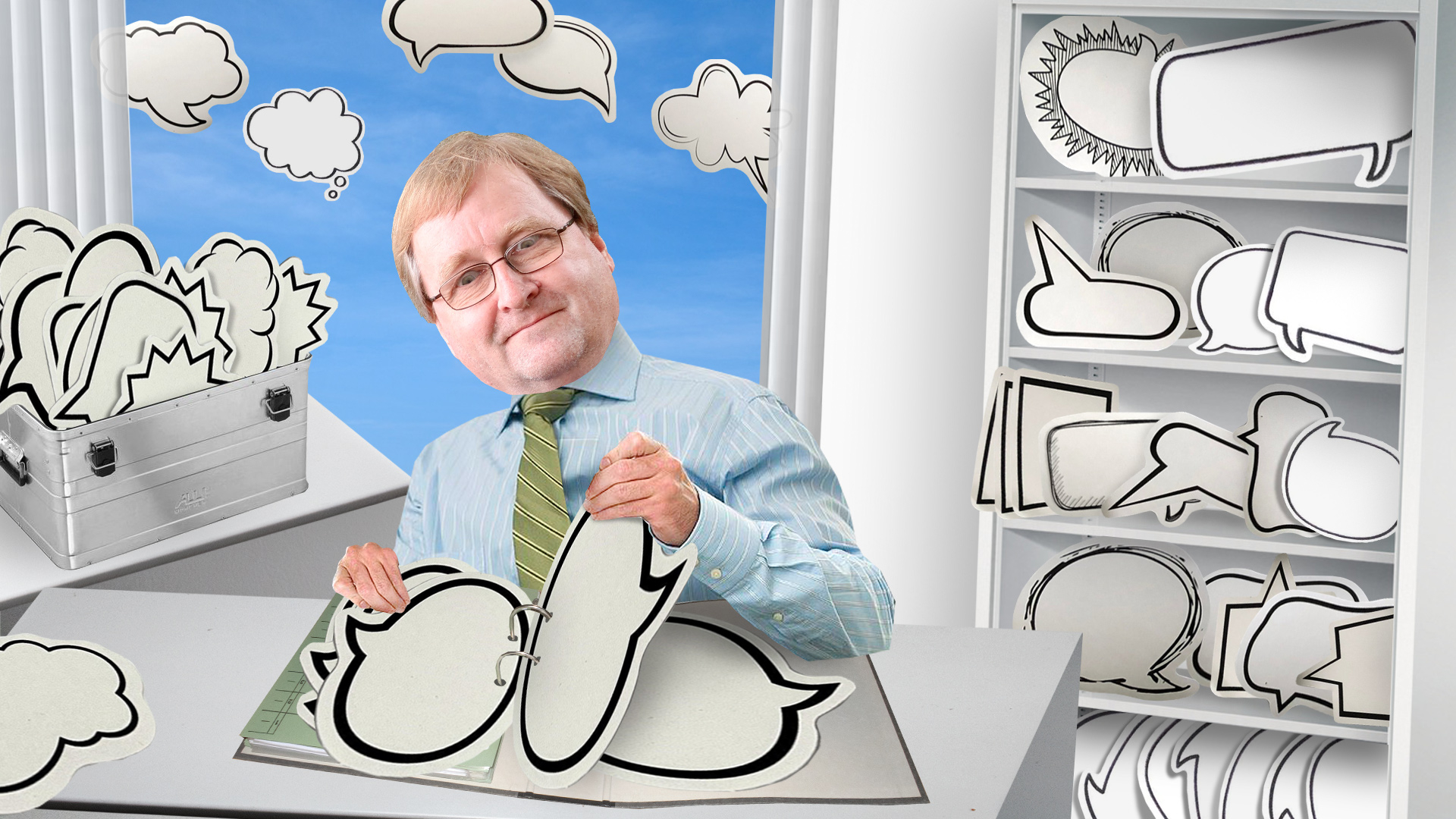
So ist es, ich zu sein: Meinungsforscher
Thomas Petersen arbeitet seit über 30 Jahren am Institut für Demoskopie Allensbach. Als Meinungsforscher untersucht er, was die Menschen in Deutschland beschäftigt. Hier berichtet er aus seiner Perspektive
Als Meinungsforscher bin ich Dienstleister für unterschiedliche Auftraggeber: Ich habe schon Marktforschung für Waschmittel, Autoersatzteile und Forstbewirtschaftung gemacht. Am bekanntesten sind die Wahlumfragen, die wir vom Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ durchführen. Dort fragen wir regelmäßig nach der Zweitstimmen-Absicht, also welche Partei die Personen wählen würden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre.
In einem Erhebungszeitraum von etwa zwei Wochen ziehen dann rund 400 Interviewer für diese und weitere Fragen durch das Land und suchen nach von uns vorgegebenen Quoten um die 1.000 Menschen, die in ihren Merkmalen – Geschlecht, Alter, Berufsstand, Einkommen und andere Faktoren – gleich zusammengesetzt sind wie die Bevölkerung insgesamt. Diese 1.000 stehen für die vielen Millionen, die ich nicht befragen kann. Daher spricht man auch von einer Repräsentativumfrage.
„Die Trendfrage, wie zufrieden man mit der Politik des Bundeskanzlers ist, wird schon seit 1949 gestellt“
Zu meinen Aufgaben gehört es, den Fragebogen zu konzipieren. Dazu muss man die oft komplexe Untersuchungsaufgabe in mehrere Einzelfragen herunterbrechen, die von den Befragten leicht beantwortet werden können. Jeder Befragte bekommt exakt die gleichen Fragen gestellt, in der gleichen Reihenfolge, im gleichen Wortlaut. Man nennt das „Standardisierung“. Es ist die Voraussetzung dafür, dass die Antworten miteinander verglichen und gezählt werden können.
Die Trendfrage, wie zufrieden man mit der Politik des Bundeskanzlers ist, wird schon seit 1949 immer wieder gestellt. Aber natürlich werden auch immer wieder neue Fragen entwickelt, je nachdem, was gerade gesellschaftlich debattiert wird. Im aktuellen Wahlkampf sind das besonders die Themen Einwanderung und Wirtschaft.
Unsere Bevölkerungsumfragen finden in der Regel „Face to Face“ statt. Das bedeutet, dass Interviewer an Haustüren klingeln und versuchen, Menschen zum Gespräch zu bewegen. Diese persönlichen Interviews bieten die besten, intensivsten Fragemöglichkeiten. Ein solches Interview kann, je nach Fragenkatalog, bis zu einer Stunde dauern, während Menschen am Telefon maximal 20 Minuten dranbleiben. Ein weiteres Problem bei Telefonumfragen ist die geringe Teilnahmebereitschaft. Oft machen nur 20 Prozent derer, die wir am Telefon erreichen, bei einer Umfrage mit.
Bei Onlinebefragungen greifen wir auf sogenannte „Access Panels“ zurück. Das sind große Datenbanken mit den E-Mail-Adressen von Zehntausenden Menschen aller Gesellschaftsschichten, die zugestimmt haben, sich interviewen zu lassen.
„Für mich ist es ein Privileg, Meinungsforscher zu sein, denn wir haben unsere eigene Informationsquelle“
Umfrageinstitute weisen darauf hin, dass ihre Erhebungen den Wahlausgang nicht vorhersagen können. Stattdessen versuchen sie, einen repräsentativen Zwischenstand im Prozess der Meinungsbildung zu erfassen.
Wenn die Fragebogen zurückkommen, werden die Antworten in den Computer eingegeben und ausgezählt. Auf Basis dieses Datensatzes kann ich dann wiederum die Daten in Diagramme übersetzen und einen Bericht schreiben, der die Ergebnisse für den Auftraggeber verschriftlicht und analysiert. Damit verdiene ich mein Geld.
Für mich ist es ein Privileg, Meinungsforscher zu sein, denn wir haben unsere eigene Informationsquelle. Wir können herausfinden, was die Menschen denken und fühlen, was sie umtreibt und wie sie sich verhalten, ohne dabei auf die Interpretationen von Journalisten oder anderen Beobachtern angewiesen zu sein, die die Lage aus ihrer subjektiven Sicht beschreiben.
Trotzdem gibt es viele Menschen, die Umfragen nur dann glauben, wenn die Ergebnisse ihre Vorurteile bestätigen. Wenn sie das nicht tun, sind sie angeblich unseriös, falsch und manipulativ. Außerdem neigen Menschen dazu, eher Einzelfällen zu glauben, frei nach dem Motto: „Das kann ja gar nicht stimmen. Ich kenne niemanden, der so denkt.“
Auch wenn das einige anders sehen, haben Umfragen einen sehr geringen Einfluss auf das Wahlverhalten (Es gibt Studien, die darauf hindeuten, Anm. d. R.). Gesellschaftliche und mediale Debatten können jedoch bestimmte Wählergruppen unter Druck setzen, sodass diese sich eingeschüchtert fühlen und bei Umfragen nicht mehr offen zugeben, welche Partei sie wählen. AfD-Wähler trifft das aktuell übrigens nicht: Die stehen häufig sehr selbstbewusst zu dem, was sie wählen und gewählt haben.
„Die Meinungsforschung macht aus Ideologiefragen Sachfragen“
Wesentlich stärker ist der Einfluss der Medienberichterstattung auf die Meinungsbildung. Viele Medienhäuser wollen unbedingt die bestmögliche Schlagzeile aus unseren Ergebnissen basteln. So lese ich fast täglich Überschriften wie „Umfrage-Hammer: SPD stürzt ab!“. Dahinter verbirgt sich dann nicht selten eine Veränderung von einem oder zwei Prozentpunkten. Dabei sind solche minimalen Ab- und Zunahmen in den Prozentangaben völlig normale Zufallsschwankungen.
Politiker und Parteien schauen genau auf Umfragen, denn sie müssen wissen, was die Bevölkerung umtreibt. Ich glaube aber nicht, dass die Politik fundamental anders wäre, wenn es Umfrageforschung nicht geben würde. Denn das Ringen der Parteien, die öffentliche Auseinandersetzung und die mediale Berichterstattung darüber würden weiterhin existieren. Es würde aber sicherlich mehr Spekulationen und Fake News geben.
Die Meinungsforschung macht aus Ideologiefragen Sachfragen. Wir ziehen einen Boden der Fakten unter die weltanschaulichen Auseinandersetzungen, die gesellschaftlich und politisch ausgehandelt werden. In einer Welt, in der stetig Behauptungen darüber kursieren, was eine Bevölkerung angeblich will und was nicht, können wir uns durch wissenschaftliche Methoden der Wahrheit annähern. Damit ersetzen wir aber keine demokratischen Prozesse. Meinungsforschung ist kein Ersatzparlament. Sie kann Meinungen und Stimmungen ermitteln, aber keine politischen Entscheidungen umsetzen.
Dr. Thomas Petersen, 56, ist Projektleiter und Experte für Wahlforschung am Institut für Demoskopie Allensbach und Privatdozent für Kommunikationswissenschaft an der Technischen Universität Dresden.
Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften, die Prozesse messen können, stehen die Sozialwissenschaften vor methodischen Herausforderungen. Gesellschaftliche Phänomene sind komplex, stetig im Wandel und von vielen Faktoren beeinflusst. Umfragen liefern daher nur Annäherungen an die Realität und keine festen Gesetzmäßigkeiten – was sie nicht weniger seriös macht.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.