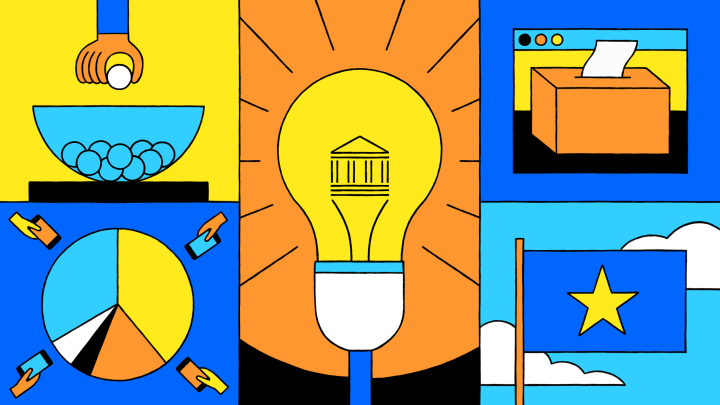Populismus: Gefahr oder Chance?
Populismus zersetzt und zerstört Gesellschaften, sagen die einen. Im Gegenteil, er kann Demokratien offener und gerechter machen, sagen andere. Unsere Autorinnen streiten

Einen guten Populismus gibt es nicht
findet Till Schmidt
Ob in Großbritannien, den USA, Ungarn, der Türkei, in Brasilien oder auf den Philippinen – die populistische Internationale ist ein echtes Gruselkabinett. So viel Wertung sei schon zu Beginn erlaubt.
Der Begriff Populismus ist aktuell in aller Munde. Deshalb gibt es gute Gründe, ihn mit Vorsicht zu verwenden. Sie alle mit dem Etikett Populisten zu versehen, dürfte zunächst dem Selbstverständnis mancher Populisten selbst widersprechen. Nehmen wir etwa Jeremy Corbyn, der es eher mit Hamas und Hisbollah als mit Donald Trump hält. Auch können wir schnell die Unterschiede zwischen den als „populistisch“ bezeichneten Politikerinnen, Parteien und Bewegungen aus den Augen verlieren, wenn wir sie stur an der allgemein akzeptierten Minimaldefinition von Populismus messen.
Populisten brauchen klare Feindbilder
Die besagt nicht mehr, als dass Populisten einen unauflöslichen Gegensatz beschwören zwischen der korrupten, um sich selbst kreisenden Elite auf der einen Seite und dem „wahren Volk“ auf der anderen. Populisten meinen, dass nur sie befugt und in der Lage sind, dieses Volk zu vertreten.
Deshalb widerspricht jeder Populismus im Kern auch dem Pluralismus unserer Gesellschaft. Er läuft auf den Ausschluss unliebsamer Menschen und Meinungen aus dem beschworenen Kreis des „authentischen Volkes“ hinaus. Diese Menschen zählen dann entweder zur Gegenseite der verhassten Elite, so etwa kritische Journalisten („Lügenpresse“) oder Politiker konkurrierender Parteien („Alt-“ oder „Establishment-Parteien“).
Oder sie werden als Angehörige von sexuellen, ethnischen oder religiösen Minderheiten ausgeschlossen. Diesen Platz haben in Europa traditionell bestimmte Gruppen eingenommen – Juden etwa oder Geflüchtete. Allein der Blick zurück auf das massenmörderische 20. Jahrhundert sollte reichen, um jeder politischen Gruppe gegenüber misstrauisch zu sein, die klare Feinde braucht, um überhaupt ein „Wir“ beschwören zu können.
Populistische Bewegungen tendieren immer dazu, menschenverachtend zu sein
Das gilt nicht nur für Rechtspopulisten. Sondern auch für sich als progressiv oder links verstehende Kräfte, die populistisch gegen den Neoliberalismus oder den aktuellen Rechtsruck vorgehen. Wie die Occupy-Bewegung in den USA oder die neuen linken Parteigründungen wie Podemos in Spanien, Syriza in Griechenland oder La France insoumise in Frankreich. Sie alle waren inspiriert von der Star-Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe. Kürzlich hat Mouffe den Linkspopulisten eine neue Programmschrift vorgelegt: „Für einen linken Populismus“.
Mouffes linker Populismus ist an vielen Stellen gar nicht schlecht gedacht. Er verzichtet beispielsweise auf die starren Freund-Feind-Verhältnisse der Rechtspopulisten. Mouffe setzt stattdessen auf die Konkurrenz zwischen politischen Kontrahenten, die sich mit Achtung begegnen. Auch verschweigt sie nicht, dass „das Volk“ immer eine Konstruktion ist, die stark vereinfacht. Denn die Individuen, die dieses Volk ergeben, bringen unterschiedliche Argumente und Forderungen vor, keinen von vornherein einheitlichen Volkswillen, der gegen die Eliten verteidigt werden will.
Trotzdem wird auch Mouffe die zentralen Probleme eines jeden sich als nicht rechts verstehenden Populismus nicht los. So bleibt sie etwa die Antwort auf die drängende Frage schuldig, weshalb sich Menschen davon überzeugen lassen, dass sie bei allen kulturellen, religiösen oder anderen Unterschieden ähnliche Interessen verfolgen. Doch vor allem geht Mouffes linkem Populismus die Empirie ab. Wie geht ihr naiver Glaube an das Volk damit zusammen, dass Pegida-Kundgebungsteilnehmer, die ebenfalls zum Volk gehören, in Dresden im Chor „Absaufen! Absaufen!“ schreien? Ist das eine fehlgeleitete Artikulation des Unbehagens am Neoliberalismus? Nein, diese Menschen sollte man in ihren Forderungen ernst nehmen: Sie brüllen, damit Menschen sterben, bevor sie überhaupt den Anspruch erheben, Teil dieses Volkes zu werden.
Der Gedanke, das Volk wird schon das Richtige wollen, ist naiv
Mouffe konstruiert das „gute Volk“ quasi aus dem sozialen Nichts. Sie denkt: Die Leute werden schon das Richtige wollen. Das ist naiv, denn Gesellschaft ist keine widerspruchsfreie Zone. Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder Homophobie sind seit jeher Teil unserer Sozial- und Kulturgeschichte – und kein Monopol der Rechten. Die Menschen, die Mouffe für ihr „Volk“ in den Dienst nehmen will, kommen nicht aus dem Setzkasten. Sie bringen eigene, manchmal rassistische oder antisemitische Denkmuster und Affekte mit. Diese Ambivalenz des Volkes lässt sich wunderbar an der Gelbwesten-Bewegung in Frankreich beobachten. Mouffe aber ignoriert diesen entscheidenden Aspekt einfach – und damit auch die Gefahren, die populistische Sammlungsbewegungen mit sich bringen.
Man sieht: Nicht nur ein dezidiert rechter, sondern auch ein sich als links verstehender Populismus verschärft den politischen Diskurs. Im schlimmsten Fall schafft er die Demokratie so ab. Und ersetzt sie auf Kosten der Minderheiten und einer pluralistischen Gesellschaft durch eine undemokratische Regierungsform.
Populismus kann Demokratien frisch halten
erwidert Paula Diehl
Man vergisst es leicht, aber unsere Demokratie lebt von Spannungen. Schon zwischen ihren zwei Grundprinzipien knistert es. Da wäre zum einen die Volkssouveränität: In der Demokratie hat das Volk die Macht, Politik soll nach seinem Willen geschehen. Da wäre zum anderen das konstitutionelle Prinzip. Also die Regeln, die unser Zusammenleben bestimmen, die politische Ordnung stabilisieren und für alle gelten.
Die Volksmacht hat eine unmittelbare Seite. Wenn das Volk gefragt wird – etwa per Referendum oder Bürgerbeteiligung – können konkrete Positionen der Bürgerinnen ermittelt und der momentane Wille der Mehrheit ausgedrückt werden. Die direkte Ausübung der Volksmacht unterliegt aber Schwankungen. Das, was das Volk will, kann sich schnell ändern – der Brexit lässt grüßen! Die Verfassung aber ist auf Dauer ausgerichtet. Denn Rechtsprinzipien stellen ein Regelwerk parat, das eine Orientierung für zukünftiges Verhalten geben und so die politische Ordnung garantieren soll.
Die Frage ist nicht, ob, sondern wie viel Populismus gut ist
Die Demokratie ist eine Wippe, an deren Enden jeweils eines dieser Prinzipien steht. Neigt sie sich zu sehr auf die Seite des konstitutionellen Prinzips, kann sie kippen. Dann verschwindet das Volk als Akteur der Demokratie. Neigt sie sich sehr zur Seite des momentanen Volkswillens, droht auch ein Ungleichgewicht. Dann wird Politik zum reinen Ausdruck des Volkswillens. Genau das wollen Populisten.
Dieses Ungleichgewicht kann seine Vorzüge haben. Populisten wirken als Korrektiv, wenn die Regierenden etwa nicht mehr in der Lage sind, die Bedürfnisse des Volkes zu ermitteln und zu repräsentieren. Gleichzeitig kann die Demokratie instabil werden, wenn die Volksmacht zu stark überwiegt. Wir sollten uns also nicht fragen, ob, sondern wieviel Populismus gut für die Demokratie ist.
Populismus betont, dass Politik nicht nur Elitensache ist
Dazu lohnt es, sich populistische Logik genauer anzusehen: Wie funktioniert Populismus? Wie stellt er den Volkswillen ins Zentrum?
Zunächst trennen Populisten die Gesellschaft in zwei Blöcke: in Volk und Elite. Schon diese Gegenüberstellung kann der Demokratie zugutekommen. Das Bewusstsein, dass Politik nicht nur Elitensache ist, sondern das gesamte Volk betrifft, kann zur Politisierung der Bürgerinnen führen. Oder eine Kritik der Machtverhältnisse ermöglichen, bei der nach demokratischen Korrekturen verlangt wird – immerhin verspricht die Demokratie Gleichheit. Ein Gebot übrigens, das auch begründet, warum sich manche Populismen nie positiv auf die Demokratie auswirken, beispielsweise der Rechtspopulismus. Der geht von einem Volk aus, das kulturell, ethnisch, religiös, manchmal sogar rassistisch als homogen konstruiert wird. Dieser Homogenitätskatalog verletzt das demokratische Prinzip der Gleichheit. Der Rechtspopulismus hat immer einen anti-demokratischen Kern.
Ein problematisches Maß nimmt der Populismus auch an, wenn er die Gesellschaft über den Gegensatz zwischen Volk und Elite unversöhnlich polarisiert. So wird eine konstruktive Auseinandersetzung erst erschwert, letztlich vielleicht verunmöglicht.
Populismus kann Regierende drängen, Entscheidungen transparent zu machen
Neben der Aufteilung zwischen Volk und Elite gehört zum Populismus auch die Kritik an etablierten Parteien und das Verlangen nach Rechenschaftspflicht und Antwortbereitschaft der Regierenden. Wenn Populisten die repräsentative Demokratie anklagen, das Volk nicht richtig zu repräsentieren, seine Bedürfnisse nicht zu kennen, ja gar nicht erst abzufragen, kann sich die Klage produktiv auf das Verhalten der Regierenden auswirken. Sie können etwa unter Druck geraten, ihre Entscheidungen transparenter zu machen oder ihre Wählerinnen eingehender zu befragen. Gefährlich wird die Kritik an den Regierenden dann, wenn sie zu einer generell antipolitischen Haltung führt: „Das alles nützt nichts, die da oben sind nur korrupt!“
Wir sehen: Eine gesunde Antihaltung gegenüber politischen Institutionen ist immer ein schmaler Grat. Der Populismus pflegt ein ambivalentes Verhältnis zur Demokratie, kann aber im richtigen Maß durchaus positiv wirken. Besonders, weil die Kenntnis der fruchtbaren Eigenschaften des Populismus uns auch im Umgang mit ausgesprochenen Antidemokraten hilft.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.
Collagen: Renke Brandt