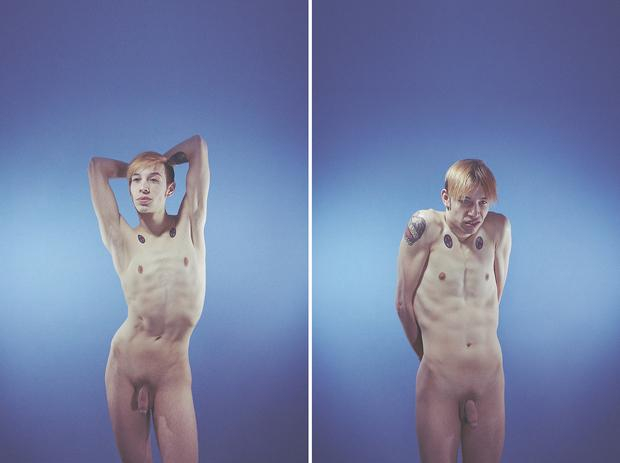Ständig im Minus
Einiges deutet darauf hin, dass soziale Ungleichheit und permanente Geldsorgen Krankheiten wie Depression fördern. Susanne hat es selbst erlebt

Der Wecker klingelt – einmal, zweimal, dreimal. Nach dem zehnten Mal hört er endlich auf. Sie bleibt liegen. Dreht sich um. Will weg. Aber aufstehen, dafür fühlt sich ihr Körper zu schwer an. Das ganze Leben fühlt sich zu schwer an. Die Depression lacht hämisch zu ihr rüber, flüstert ihr zu, dass das alles keinen Sinn mehr hat. Was sie jetzt bräuchte, ist Hilfe, finanzielle und therapeutische – beides stünde ihr zu, doch auf beides hofft sie vergebens. Obwohl sie immer ihr Bestes gegeben und hart gearbeitet hat. Ihre Auftraggeber warten auch jetzt vermutlich schon mit den ersten E-Mails. Diese Selbstständigkeit als Webdesignerin hat sie sich anders vorgestellt. Vieles hat sie sich anders vorgestellt. Aber Pause machen geht nicht. Beim Jobcenter sind depressive Phasen, in denen schon der Besuch beim Arzt für ein Attest zu viel wird, keine anerkannte Kategorie. Und selbst als ein Neurologe ganz offiziell eine Depression diagnostizierte, hieß das noch lange nicht, dass Susanne unmittelbar behandelt werden konnte. Therapeuten haben vollere Terminkalender als so mancher Prominente, sie können den nächsten freien Platz meist erst in ein paar Monaten anbieten. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen die Therapie in der Regel, doch einen Platz zu finden und damit ganz konkret anzufangen ist häufig ein Problem – vor allem, wenn man niemanden hat, der hilft.
Andererseits ist das Gefühl, auf Hilfe angewiesen zu sein, für Susanne kaum erträglich. Von klein auf hat sie es vermieden, sich auf Unterstützung zu verlassen. Denn wenn sie es doch mal tat, war da niemand. Nicht im Kindesalter, als sie ihr Erspartes opfern musste, nicht als Heranwachsende, als sie sich von zu Hause lösen wollte, und auch nicht als Erwachsene, als sie versuchte, auf eigenen Beinen zu stehen. Susanne weiß: Wenn sie sich selbst nicht helfen kann, bleibt sie hilflos.
Nach Feierabend fiel Susanne sie in einen Sumpf von Einsamkeit und gefühlter Wertlosigkeit
Die heute 34-Jährige wurde in der damaligen DDR geboren, ihre Mutter war alleinerziehend, arbeitete viel und war fast nie zu Hause. Trotzdem reichte es nie aus. Schon früh lernte Susanne, was es bedeutet, kein Geld zu haben. Konnten Rechnungen nicht bezahlt werden, und so war es oft, bediente sich die Mutter an dem Sparschwein ihrer Tochter. Sogar als Susanne sich mit 19 Jahren etwas für den Start ins eigene Leben dazuverdiente, wurde ihr Gehalt vom Sozialhilfesatz der Mutter abgezogen.
„Schon da habe ich erlebt, dass meine Arbeit nicht belohnt und anständig bezahlt wird“, erinnert sie sich. „Ich brauchte das Geld, weil ich von zu Hause rausmusste, aber es wurde mir einfach weggenommen.“
Auf der Arbeit versuchte sie, mit ihrer Leistung zu überzeugen, und das funktionierte auch erst mal ganz gut. Aber sobald Feierabend war, fiel Susanne in einen Sumpf aus Einsamkeit und gefühlter Wertlosigkeit. Als sie für ein Praktikum in eine andere Stadt ziehen musste, fehlte ihr das Geld für die Kaution, und sie bat ihren Vater um Unterstützung. Tagelang hörte sie nichts von ihm – bis er ihr beiläufig mitteilte, er könne ihr nicht helfen. Auch das Jobcenter steuerte kein Geld für die Umzugshilfe bei. Bei einem Praktikantengehalt von 460 Euro, das sie zu diesem Zeitpunkt bezog, blieb in einer teuren Großstadt neben Miete und Fahrkarte nicht viel übrig.

„Ich hatte keine Ahnung, wo ich in drei Wochen schlafen soll. Das waren fürchterliche Existenzängste.“
Mit Mitte zwanzig machte sich Susanne selbstständig. Sie wollte sich endlich eine solide Existenz aufbauen und nicht mehr auf die Unterstützung anderer angewiesen sein. Doch: „Ich habe so viel geackert, mein Zeug immer rechtzeitig abgegeben, aber wann deine Rechnung bezahlt wird, weißt du nicht.“ Verlässlich wurde in ihrem Leben nur, dass sie ihre Miete und den Strom regelmäßig nicht bezahlen konnte. Sie geriet in einen Teufelskreis: überhäufte sich mit Arbeit, wurde enttäuscht und um den Lohn für ihre Anstrengung betrogen und lag schließlich wieder reglos im Bett – ohne Energie, auch nur den kleinen Finger zu bewegen. Müde vom Aufstehen und Hinterherrennen. Voller negativer Gefühle sich selbst und anderen gegenüber.
So dringend es gewesen wäre, in dieser Zeit finanzielle Unterstützung zu beantragen, war es Susanne doch unmöglich. Dazu fehlte ihr jegliche Zuversicht, dass am Ende etwas dabei herumkommt. Wieso sollten sie und ihre Bedürfnisse diesmal ernst genommen werden? Ihre Not hatte schon als Kind und als Heranwachsende niemanden interessiert. Außerdem wusste sie nicht einmal, wie lange die depressive Phase diesmal andauern und ob sich der Aufwand überhaupt lohnen würde. „Das waren dann vielleicht ein paar Wochen, in denen ich nicht arbeiten konnte und ins Minus fiel. Dafür kann ich doch nicht extra zum Jobcenter rennen. Bis da was passiert, ist die Phase wieder vorbei.“ Erst recht fehlte ihr die Kraft, all die bürokratischen Hürden zu nehmen, um einen Therapieplatz zu ergattern. In solchen Phasen befand Susanne sich im freien Fall.
Mit der jahrelangen Finanznot war Susanne auch in Anerkennung und Liebe tief ins Minus gerutscht
Und doch fing sie sich immer wieder auf. Als sie erneut eine Festanstellung annahm und zumindest die existenzielle Not gelindert war, trat ein anderes fundamentales Defizit zutage: Mit der jahrelangen Finanznot war Susanne auch in Sachen Anerkennung und Liebe tief ins Minus gerutscht. Nun erhoffte sie sich von ihren neuen Kollegen, dass sie das mit Zuneigung und Bestätigung ausgleichen würden. Doch diese Menschen waren nicht ihre Ersatzfamilie und kümmerten sich genauso wenig um sie wie ihre leiblichen Verwandten.
Knut Jöbges, Leiter der Fachtherapien in der Schön Klinik Bad Arolsen, arbeitet seit vielen Jahren mit Patienten mit unterschiedlichen psychosomatischen Krankheiten zusammen und kennt den Zusammenhang zwischen sozialer Benachteiligung, Existenzängsten und Depression:
„Persönliche emotionale Unsicherheit und nicht gestillte Wünsche nach Geborgenheit können durch instabile soziale Bedingungen, unsichere materielle Verhältnisse, vor allem Geldnot, ständig reaktiviert werden und so in einen Kreislauf von Depression und prekären finanziellen Verhältnissen führen. Eine unsichere, nicht gehaltene soziale Situation kann auf emotionaler Ebene auch immer wieder die gleichen schmerzhaften Erinnerungen aus der Kindheit reaktivieren und aufrechterhalten.“
Wobei Jöbges betont, dass natürlich auch das Bezwingen von sozialen Nöten kein Garant dafür ist, eine Depression zu überwinden:
„Soziale Sicherung ist nur die äußere Bedingung dafür, dass Menschen ihr Inneres klären und befrieden und somit bestenfalls auch ohne Depression durchs Leben gehen können. Kümmert sich der Betroffene nicht aktiv um seine psychische Gesundheit, besteht sogar die Möglichkeit, die eigenen emotionalen Verwundbarkeiten und vielleicht sogar die Anfälligkeit für Depression in die nächste Generation zu vererben.“
Die Arbeitsatmosphäre wurde von Monat zu Monat unangenehmer und immer öfter verschwand Susanne heulend auf der Toilette
Susannes Versuch, sich durch Leistung Liebe zu erarbeiten, scheiterte. Die Arbeitsatmosphäre wurde von Monat zu Monat unangenehmer, und immer öfter verschwand sie heulend auf der Toilette. Diesmal rutschte sie in die Depression, obwohl sie Geld hatte – und sie gab es aus, bis nichts mehr davon übrig war.
Die Flucht hinaus aus ungesunden Arbeitsbedingungen und schädlichen Verhaltensmustern war zugleich die Flucht nach vorn auf der Suche nach einem Therapieplatz. „Ich war beim Berliner Krisendienst, aber die machen auch nicht viel mehr, als dir ein Mal für eine Stunde zuzuhören und dir ein paar Flyer in die Hand zu drücken.“ Von dort wurde Susanne an eine Stelle verwiesen, die Psychologen ausbildet und schneller Therapieplätze vermitteln soll: „Ich sagte, dass ich dringend einen Therapieplatz suche, und dann schaut mich diese Rezeptionistin an und antwortet: ‚Damit kann ich Ihnen momentan nun wirklich nicht dienen. Gehen Sie doch am besten zum Berliner Krisendienst.‘“ Eine Beratungsstelle, die darüber informiert, welche Therapieform die richtige für sie wäre, suchte Susanne vergebens. Ihr blieb nichts anderes übrig, als den Hörer selbst in die Hand zu nehmen.
„Wenn ich aber in einer Depression stecke, fällt es mir sowieso schon enorm schwer, mit Menschen in Kontakt zu treten. In 90 Prozent der Fälle landet man auf dem Anrufbeantworter, hört von den meisten Therapeuten gar nichts oder erhält eine Absage.“
Irgendwann meldete sich eine Verhaltenstherapeutin zurück. Danach dauerte es noch mal zehn Wochen bis zu einem Kennenlerntermin und drei Probestunden, bis sie einen festen Wochentermin bekam, für den sie schon sehr bald eine Verlängerung bei der Krankenkasse beantragen musste. Nach vier Monaten der Suche, etlichen Behördengängen, unzähligen Formularen und sechs Monaten mit wöchentlichen Sitzungen war fast ein Jahr vergangen. Was hatte es ihr gebracht?
„Eigentlich nichts“, sagt Susanne. Außer dass sie wieder an sich selbst zweifelte und die Therapeutin einen Haufen Geld verdient hatte. Sie habe ihr zugehört, und das habe auch gutgetan. Aber über Reden ging es nicht hinaus. Von einer Verhaltenstherapie hätte sich Susanne mehr Aktion und vor allem eine spürbare Veränderung erhofft. Heute wisse sie, dass man jahrelanges Leiden nicht in ein paar Monaten aufarbeiten kann und es auch um die richtige Therapieform geht.

Nach der gescheiterten Behandlung fiel sie zurück in ihre lethargischen Bettphasen. Doch ihr Gehirn hungert nach Input. Endlos zog sie sich Dokumentarfilme, TED-Talks und Wissensvideos rein – nicht ahnend, dass sie ausgerechnet dabei auf etwas Rettendes stoßen würde: „Eines Tages sah ich eine Dokumentation über Kulturen, die Depression als eine Art seelisches Erwachen zelebrieren. Das hat mir geholfen, das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.“
Experte Knut Jöbges bestätigt: „Seelische Krisen werden in traditionelleren Kulturen als Chancen für persönliches Wachstum und tiefgreifende Veränderung der Haltung zu sich und dem Leben wahrgenommen.“
Dafür, dass sie sich jetzt mehr um sich selbst kümmern kann, zahlt sie einen hohen Preis
Dieser Impuls inmitten ihrer dunkelsten Phase gab Susanne etwas, das sie jahrelang vergebens gesucht hatte: den Glauben an sich selbst. Mit dieser neuen Zuversicht schaffte sie es, sich um einen Klinikplatz zu kümmern, und trat ihn drei Monate später an. In den ersten beiden Wochen wurde nur gepuzzelt und gespielt, das System heruntergefahren und das Hamsterrad angehalten. Danach brach es umso heftiger aus ihr heraus: Sie wurde wütend, sie traute sich, laut zu werden, zu schreien, all die angestauten Enttäuschungen herauszulassen – mit Kunst, mit Sport, mit Streit, mit allem, was ihr zur Verfügung stand. Hier gab es kein paralleles, „normales“ Leben, das ablenkte. Es wurde auch nicht nur geredet, sondern Strategien entwickelt und umgesetzt. Erstmals hatte Susanne ein Gefühl von Vorankommen und Entwicklung. „Das war ein Wendepunkt für mich“.
Seitdem versucht sie, sich auf das zu konzentrieren, was ihr guttut, und für sie schädliche Handlungen, Dinge oder Personen zu meiden. Psychohygiene nennt sie das, aber einfach sei das nicht. Immer wieder müsse man sich erklären und rechtfertigen. Auch als potenzielle Arbeitnehmerin: „Ich habe nach wie vor etliche Jobangebote, aber ich lehne sie ab, weil sich sonst alles wiederholen würde.“
Dafür, dass sie sich jetzt mehr um sich selbst kümmern kann, zahlt Susanne einen hohen Preis: Sie lebt nach wie vor von Hartz IV. Anders gehe es derzeit nicht, weil sie noch nicht stabil genug sei, um zu arbeiten. Was wiederum, trotz des Therapieerfolges, ihre Existenzangst ständig am Köcheln hält. Eine Idee, wie sie den Teufelskreis aus Geldnot, Angst, mangelndem Selbstwertgefühl und Depression durchbrechen könnte, hat Susanne durchaus. Sie würde gerne studieren. Doch von drei BAföG-Stellen hat sie bereits eine Absage kassiert. Sie sei zu alt für diese Art der Unterstützung, sie fiele eben durchs Raster.
Was muss ich als gesetzlich Krankenversicherter bei einer Therapiesuche beachten?
Derzeit werden nur die Kosten von drei als wissenschaftlich fundiert anerkannten Therapieformen von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen: die analytische Psychotherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die Verhaltenstherapie. Der Begriff „Therapeut“ ist in Deutschland gesetzlich nicht geschützt, wird aber für viele Berufsbilder verwendet. Daher ist wichtig zu wissen: Nur ärztliche und psychologische Psychotherapeuten haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium absolviert, entweder in dem Fach Medizin oder der Psychologie.
Nach einer Therapie Suchende sind mit einer Vielzahl an psychotherapeutischen Methoden konfrontiert, über die man sich zum Beispiel auf der Plattform www.therapie.de informieren kann.
Nicht jede Methode ist für jeden gleichermaßen geeignet. Leider ist die Psychotherapieforschung noch nicht weit genug fortgeschritten, sodass man heute noch keine verlässlichen Aussagen darüber treffen kann, welche Methode für welche Störung und für welchen Persönlichkeitstyp die geeignetste ist. Jede Therapie ist zudem ein Zusammenspiel von Methode und Therapeut, daher sollte auch die persönliche Beziehung zwischen Therapeut und Klient stimmen. Der Klient sollte sich frei, ernst genommen und wohl dabei fühlen, mit dem entsprechenden Therapeuten zu arbeiten. Andersherum gilt dasselbe.
Je nach Wohnort und Krankheitsbild variiert auch die Suche nach einem geeigneten Therapieplatz. Hier ein paar Schritte, die jeder Klient durchlaufen sollte:
Es ist empfehlenswert, anfangs den Arzt aufzusuchen, der einen am besten kennt. In der Regel ist das der Hausarzt. Dieser kann häufig mit therapeutischen Adressen beziehungsweise Kontaktmöglichkeiten weiterhelfen, oft auch auf ein spezifisches Problem bezogen und sortiert nach kassenunterstützten Plätzen.
- Viele Betroffene investieren viel Zeit in Eigenrecherche, um sich über verschiedene Therapieformen zu informieren und dadurch das eigene Problem beziehungsweise die daraus entstehenden Bedürfnisse besser zu erfassen.
- Anschließend kontaktieren sie die herausgefilterten therapeutischen Praxen, meistens per Anruf oder E-Mail.
- Sofern freie Plätze verfügbar sind, wird ein Termin zum Erstgespräch vereinbart.
Bei diesem Erstgespräch lernen sich Therapeut und Klient kennen, klären organisatorische Fragen (z.B. zu Bezahlung, Dauer oder Methode) und versuchen, einen ersten Eindruck des Gegenübers zu bekommen, um zu entscheiden, ob sie miteinander arbeiten können beziehungsweise möchten.
- Anschließend folgen die Probesitzungen (probatorische Sitzungen): Darunter versteht man die Therapieeinheiten, die stattfinden, bis die Krankenkasse eine schriftliche Zusage zur Kostenübernahme erteilt. In der Regel tragen die Krankenkassen die Kosten für bis zu acht solcher Sitzungen.
- Sobald die Krankenkasse die Kostenübernahme bewilligt hat, beginnt die Arbeitsphase: In der Regel wird zunächst entweder eine Kurzzeittherapie von 25 Sitzungen oder eine Langzeittherapie von 45 beziehungsweise 50 Sitzungen beantragt. Bei Bedarf kann im Anschluss daran in mehreren Schritten noch verlängert werden.
- Nach dieser Zeit kann man eine Verlängerung bei der Krankenkasse beantragen, oder man erklärt die Therapie für erfolgreich beendet. Abbrechen kann man natürlich jederzeit.
Fotos: Franna Linden / Edith images