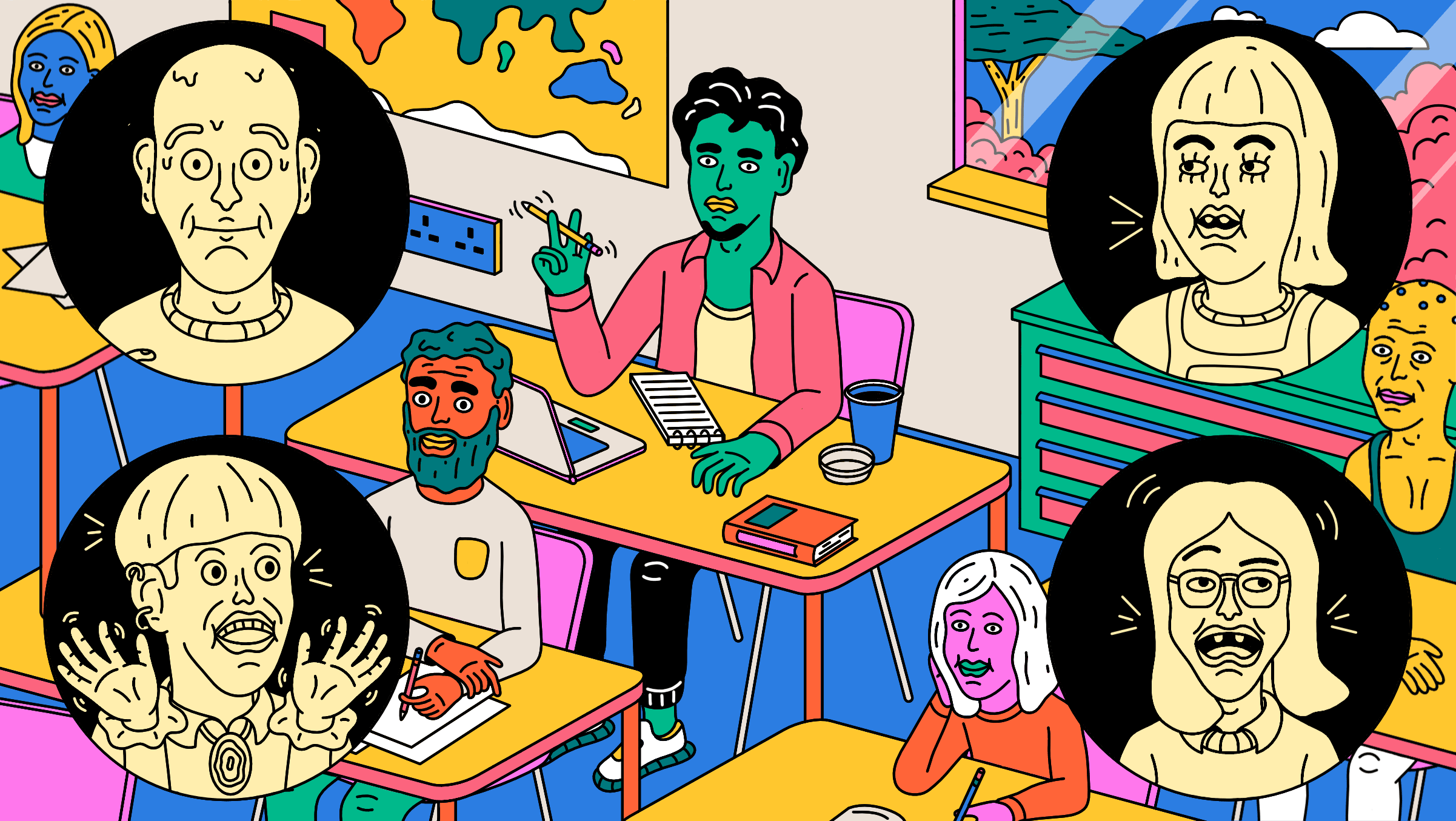Es heimatet sehr
Für sein Buch „Germania“ hat Juri Sternburg Rapgrößen mit Migrationsgeschichte getroffen. Was er dabei über Deutschland und Heimat, über Fremdsein und Fremd-gemacht-Werden gelernt hat

Ich habe ein Buch geschrieben. Ein Buch über Flucht und Heimat, über Alltagsrassismus und Dankbarkeit, ein Buch über Deutschland aus der Sicht aller, die nicht Peter oder Gisela heißen. Dabei sind es gar nicht meine Geschichten. Es sind die von Kool Savas und Hatice Schmidt, von Lady Bitch Ray und Capital Bra, von Sugar MMFK, Manuellsen, Massiv und vielen anderen öffentlichen Personen mit Migrationsgeschichte. Oft sind es vor allem die Geschichten ihrer Eltern und Großeltern. In Interviews wurde ich anschließend gefragt, was Heimat für mich ist. Ich konnte und wollte diese Fragen nicht beantworten. Aber ich habe während des Schreibens hin und wieder gelernt, wie die Antworten meines „Germania“ lauten könnten. Wie also Menschen darüber denken, für die Deutschland erst als Heimat erkämpft werden musste, die sich zu Hause fühlen wollen, aber das oft nicht dürfen. Ein paar ihrer Forderungen an ein postmigrantisches Deutschland habe ich hier zusammengefasst.
Niemand muss sich dankbar dafür zeigen, in Deutschland leben zu dürfen
Mein Porträt über den Rapper Massiv beginnt vor seinem schicken Sportwagen. Massiv ist dankbar. Dankbar, dass der Kapitalismus in Deutschland für ihn so gut funktioniert hat. Andere Einwanderer*innen, die weniger „dankbar“ sind, müssen sich oft schiefe Blicke gefallen lassen. Denn wer nach Deutschland gekommen ist, soll immer und überall versichern, wie toll es sei, hier (Sicherheit, Sozialstaat, Sauerkraut) leben zu dürfen. Pardon, man muss das etwas eingrenzen: Wer nicht aus Frankreich oder Norwegen, sondern aus Marokko, Pakistan oder, wie Massiv, aus Palästina hergekommen ist, soll dankbar sein. Sorry to break it to you, aber: Meiner Meinung nach müssen sich Migrant*innen nicht prinzipiell vor Deutschland in den Staub werfen. Der Grund dafür, dass es den Menschen in Deutschland oft besser geht als in ihren Heimatländern, ist simpel: Uns geht es gut, weil es ihnen schlecht geht. Dass sie hier leben wollen, ist also eine Selbstverständlichkeit.
Postmigrantisch bedeutet erst mal: nach der Migration. Das bedeutet nicht, dass Migrationsbewegungen abgeschlossen sind. Sondern dass es nach der Migration zu politischen Veränderungen, Konflikten und neuen Identitäten kommt. Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft, und immer mehr Menschen wollen das Land mitgestalten – auch wenn ihre Vorfahren nicht deutsch waren und sie selbst vielleicht nicht so aussehen, wie man sich früher Deutsche vorstellte.
Wer hier lebt, darf Fehler machen
Ich habe für das Buch nicht nur Chorknaben und Klassensprecherinnen getroffen. Einige der Künstler wie Massiv oder Kool Savas haben sich in der Vergangenheit problematisch geäußert oder straffällig verhalten. Sie im Buch zu featuren, wird mir jetzt vorgeworfen. Da wird Einwanderern wie dem Musiker Manuellsen, der eine Kutte trägt und mit den Hells Angels durch die Gegend fährt – die der Verfassungsschutz der organisierten Rockerkriminalität zuordnet –, in Kommentaren das Recht abgesprochen, überhaupt etwas über Deutschland sagen zu dürfen. Klar: Übergriffe, Missbrauch oder Gewalt gehören bestraft. Diese Strafe wird aber vor Gericht entschieden, nicht in Facebook-Kommentarspalten. In denen dominiert noch immer die Vorstellung des Strebermigranten: Einwanderer*innen, die sich tadellos verhalten, hört man vielleicht zu; wer sich einmal etwas zuschulden kommen lässt, hat aber gefälligst keine Ansprüche mehr zu stellen. Dieser Tadellosigkeitsimperativ ist unsinnig.

Man kann gern in Deutschland leben, ohne sich als Deutsche*r zu fühlen
„Ich bin drei in eins“, hat mir der Rapper Olexesh seine Herkunft erklärt. „Ich sehe mich als Russen, weil mein Vater Weißrusse ist. Ich sehe mich als Ukrainer, weil meine Mutter daher stammt. Ich bin Deutscher, weil ich hier aufgewachsen bin und die Leute mich hier gut empfangen haben, schon seit dem Kindergarten.“ Diese Aussage mag den Nationalstolz vieler herausfordern, ist aber völlig logisch: Konstrukte wie Ländergrenzen und Zufälligkeiten wie Geburtsorte sind an sich keine Gründe, irgendetwas von jemandem zu erwarten. Eine Deutsche muss nicht pünktlich sein, ein Kolumbianer nicht gut tanzen können. Vor allem aber muss sich niemand vom Staat seiner Eltern und Großeltern lossagen, um ein „guter Deutscher“ zu werden. Wieso sollen sich, während in Deutschland gejammert wird, dass Traditionen und alte Wert verschwinden, Oleg und Layla bitte möglichst von allem lossagen, was ihre Eltern ihnen mitgegeben haben?
Zu Hause eine Zweitsprache sprechen ist super – auch wenn es sich um Türkisch handelt
Viele Eltern prahlen gern mit ihren Kindern, die, kaum dreijährig, auf einem Fabergé-Ei balancierend Tuba spielen. Spricht der Knirps dann noch vor der Einschulung Französisch oder Mandarin, ist das Glück perfekt. Mit den Muttersprachen deutscher Einwanderer verhält es sich seltsamerweise ganz anders: Verfällt ein Kind ins Türkische oder Persische, wird gerne mal kritisch nachgefragt, wieso zu Hause niemand Deutsch spricht. Sprache ist Kulturgut und Privileg, genau wie Hautfarbe und Herkunft. Französisch wird tendenziell als weiß wahrgenommen, auch wenn der halbe afrikanische Kontinent die Sprache fließend spricht. Es ist kein Wunder, wenn der deutsch-marokkanische Schauspieler und Rapper Yonii berichtet: „Immer wenn mich die Polizei anhält, schwätz ich einfach Schwäääbisch. Und dann isch die Sach’ sofort geklärt. Das war schon immer meine Taktik, egal mit welchem Pass. Immer schön Schwäbisch schwätze.“
Dass mir alle zuhören, ist Teil des Problems
Meine persönlichen Erfahrungen mit Rassismus beschränken sich auf Antisemitismus. Ich kenne das Gefühl nicht, auf der Straße als „fremd“ gelesen zu werden. Ich musste noch nie um eine Wohnung oder einen Job bangen, weil ich jüdisch bin. Ich wurde noch nie in der Straßenbahn bedroht, weil ich eine andere Hautfarbe habe. Trotzdem werde ich gefragt, ob ich ein Buch über Alltagsrassismus und Migrationsgeschichte schreibe. Ich mache das, weil ich die Geschichten für wichtig und erzählenswert halte. Und weil ich damit einen Teil meiner Miete zahle. Dennoch sage ich: Gewöhnt euch an, Menschen zu fragen, die betroffen sind. Gewöhnt euch an, Menschen zu fragen, die marginalisiert sind. Reduziert sie nicht auf ihre Rassismuserfahrungen, aber hört zu, lasst sie ausreden, fragt, macht ihnen Platz in euren Timelines, Kollegien und Medien.
Titelbild: privat
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.