„Helfen kann auch etwas Übergriffiges haben“
Theresa Pleitner hat als Psychologin in einer Geflüchtetenunterkunft gearbeitet und darüber ihren ersten Roman „Über den Fluss“ geschrieben
Theresa Pleitner, Jahrgang 1991, hat Psychologie und literarisches Schreiben studiert. Als Psychologin hat sie unter anderem in einer Geflüchtetenunterkunft gearbeitet. Dort spielt auch ihr erster Roman „Über den Fluss“. Die Hauptfigur stößt darin an die Grenzen dessen, was sie bewirken kann – mit fatalen Folgen.
fluter.de: Sie selbst haben, genau wie die namenlose Hauptfigur Ihres Romans „Über den Fluss“, als Psychologin in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete gearbeitet. Wie ging es den Menschen dort?
Theresa Pleitner: Ich kann das nicht an deren Stelle beantworten, sondern nur wiedergeben, was ich mitbekommen habe. Für viele ist es eine sehr bedrängende Situation. Gerade in großen Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es sehr viele Widrigkeiten. Wie ich auch im Text schildere, gibt es dort häufig Wanzen, ständig ist das Licht an, es herrscht eine permanente Geräuschkulisse, und es gibt überhaupt keine Privatsphäre. Dazu kommen Polizeirazzien und drohende Abschiebungen. Die Aussichtslosigkeit und das Gefühl des Ausgeliefertseins an Polizei, Behörden und Personal sind für viele ganz schwer erträglich.
Wie schlägt sich diese Situation auf die Psyche der Menschen nieder?
Trauma spielte eine große Rolle. Ich finde es aber wichtig zu betonen, dass die Leute nicht nur traumatisiert ankommen, weil sie in den Herkunftsländern oder auf der Flucht Traumata erfahren haben. Auch die Umstände vor Ort können traumatisierend sein oder zu Retraumatisierungen führen. Es gibt sehr viele dissoziative Symptome („Dissoziation“ bedeutet Abspaltung, Anm. d. Red.), die sich unterschiedlich äußern, zum Beispiel in psychogenen Lähmungen, Amnesien, Depersonalisation oder Derealisation. Die Leute haben das Gefühl, neben sich zu stehen oder als sei die Welt unwirklich. Das hat viel zu tun mit dem Gefühl, keinen Einfluss auf die eigene Situation nehmen zu können, also mit einem Mangel an Selbstwirksamkeit, so nennt man das in der Psychologie. Auch Angststörungen spielen eine größere Rolle, etwa ausgelöst durch die Angst vor Abschiebung. Was ich heftig fand und mir nicht so klar war, bevor ich dort arbeitete, war die sehr hohe Rate an suizidalen Menschen, die also so verzweifelt sind, dass sie mit dem Leben hadern.
„Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Möglichkeiten hier leider begrenzt sind“
Die Hauptfigur im Roman ist eine junge Frau, die diesen Beruf mit Idealen und Überzeugungen antritt. Inwiefern muss man die aus Ihrer Sicht für diesen Job ablegen?
Natürlich ist es gut, ein Stück Idealismus zu haben, engagiert zu sein, sich einsetzen zu wollen. Es ist auch gut, einen kritischen Blick auf die eigene Rolle zu haben, auf die Verstrickung in die Machtstrukturen. Es wäre einerseits wichtig, die psychosoziale Versorgung von geflüchteten Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen zu verbessern, weil sie hier eine Anlaufstelle haben, um über das, was sie belastet, zu sprechen. Man kann Selbsthilfe-Methoden vermitteln, etwa Stabilisierungstechniken, oder die Menschen an externe Anlaufstationen vermitteln. Aber es ist andererseits auch wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Möglichkeiten hier leider begrenzt sind. Das hat damit zu tun, dass das psychische Leiden in Geflüchtetenunterkünften stärker als anderswo strukturell bedingt ist, also durch politische Missstände. Und gegen die kann man als Psycholog:in wenig ausrichten. Es ist eine große Herausforderung und frustrierend, das anzuerkennen.
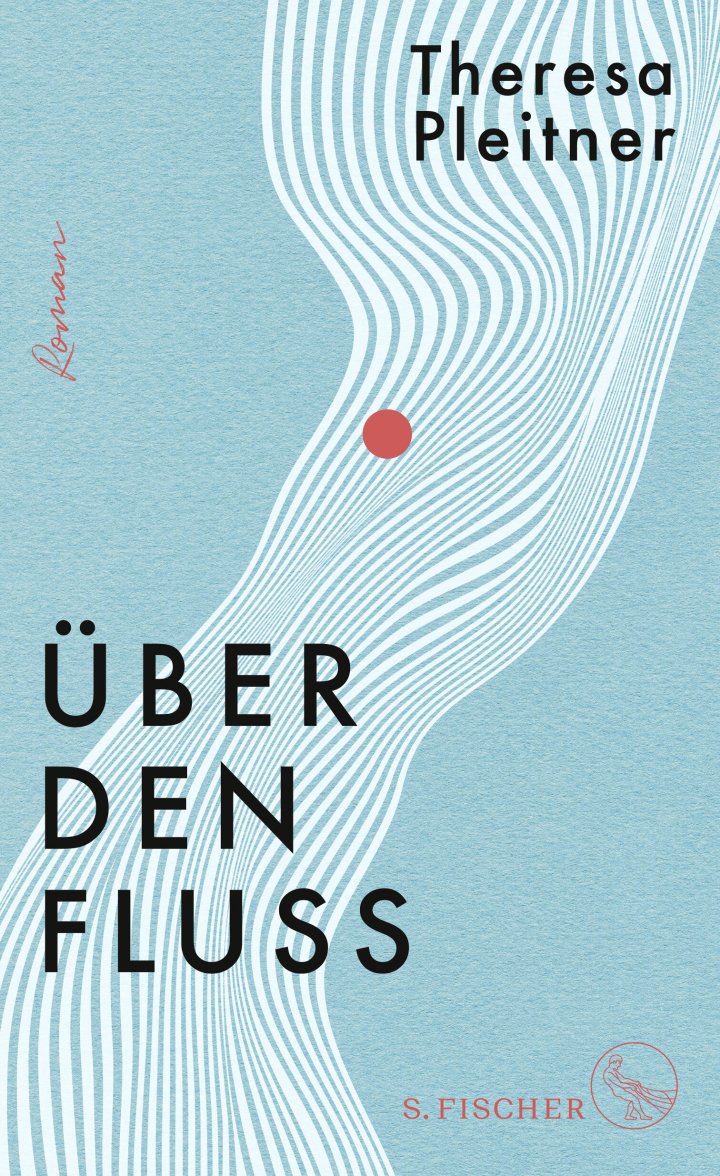
Das klingt so, als seien Sie in dem Job einen Spagat eingegangen.
Die Arbeit dort bringt immer wieder Widersprüche mit sich. Einerseits soll man als Psycholog:in zwar für das Wohl der Leute sorgen, aber man ist letztlich auch dazu angehalten, Abschiebungen zu tolerieren. Dieses Dilemma schildere ich im Text. Wer das nicht täte, könnte theoretisch Geflüchtete innerhalb der Unterkunft in eine andere „Kabine“ verlegen, ihnen also einen anderen Schlafplatz zuweisen, ohne das im Onlineverzeichnis der Einrichtung zu vermerken. So würde die Polizei die Leute nachts nicht finden und könnte sie nicht abschieben. Das wäre dann allerdings illegal und würde einem selbst vielleicht eine Kündigung einbringen, vielleicht auch einen Eintrag im Führungszeugnis, was heißt, dass man auch anderswo nicht mehr angestellt wird. Ein anderes Dilemma ist, dass man Zwangseinweisungen durchführen muss. Das muss man als Psycholog:in auch in anderen Behandlungskontexten, weil es zur Fürsorgepflicht gehört. Aber es hat eine andere Drastik an einem Ort, wo die Menschen ohnehin schon sehr vulnerabel und ausgeliefert sind.
Die Hauptfigur im Buch verzweifelt an diesen Widersprüchen.
Ich habe versucht, diesen Grundkonflikt zwischen Idealismus und Pragmatismus, Einfühlung und Abgrenzung durch die Protagonistin und ihre Kollegin Ines zu veranschaulichen: Die Protagonistin versucht, auf keinen Fall „Komplizin des Systems“ zu werden. Ihre Kollegin ist pragmatischer und kompromissbereiter, manchmal auch unsensibler und weniger einfühlsam. Letztlich ist die Herausforderung, und so habe ich es selbst erlebt, einen Mittelweg zu finden. Wenn man viel zu idealistisch ist, dann kann man handlungsunfähig werden, und dann riskiert man, psychisch an die eigenen Grenzen zu kommen. Man muss sich abgrenzen und die professionelle Distanz wahren. Und zugleich ist es natürlich wichtig, sensibel zu bleiben und die eigene Machtposition zu reflektieren.
Der Roman stellt auch die Frage, was Helfen eigentlich bedeutet. Haben Sie durch das Schreiben an Ihrem Buch eine Antwort gefunden?
Es war mir vor allem wichtig, die Fallstricke des Helfens zu beleuchten. Ich beschreibe, inwiefern das Helfen auch etwas Übergriffiges haben, ihm auch etwas Selbstgerechtes eingeschrieben sein kann. Bei der Protagonistin stellt sich die Frage, inwiefern sie diese Stelle antritt, um sich selbst zu beweisen, ein „guter Mensch“ zu sein, und sich als Retterin aufzuspielen. Das ist eine Form von „White Saviorism“. Und an einem Ort wie einer Geflüchtetenunterkunft ist so etwas besonders schwierig, weil es hier um Deutungshoheit geht. Man hat mit Menschen zu tun, die kulturell anders geprägt sind, die vielleicht andere Vorstellungen davon haben, was gesund, krank, heilsam ist und was nicht. Im Roman gibt es eine Person, die meint, von Dschinns – also Geistern – besessen zu sein. Wenn man nicht weiß, was das dort, wo die Person herkommt, bedeutet, kann es etwas Übergriffiges haben zu sagen, sie sei einfach psychotisch.
Titelbild: Theodor Barth/laif -- Andreas Labes
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.


