Warum heute jeder ein Profil hat
... früher aber nur Kriminelle und Kranke. Der Kulturwissenschaftler Andreas Bernard beschreibt in seinem Buch „Komplizen des Erkennungsdiensts“ die freiwilligen Fußfesseln der sozialen Medien
Wer „Pokémon Go“ spielt, muss sich über das Smartphone orten lassen. Ebenso wer Google Maps nutzt oder einen Fitness-Tracker. Die Geräte und Programme nutzen eine Technologie, die man bis vor zehn Jahren eher mit der elektronischen Fußfessel in Verbindung gebracht hätte. Wir sprachen mit Andreas Bernard, Professor am Center for Digital Cultures der Leuphana Universität Lüneburg, darüber, warum wir uns heute im digitalen Alltag ständig freiwillig selbst vermessen – und dabei intimste Daten preisgeben.
fluter.de: Herr Bernard, Sie schreiben, dass bis vor 20 Jahren vor allem für Serienmörder oder Psychiatriepatienten Profile existierten. Das dürfte vielen Nutzern sozialer Medien nicht bewusst sein.
Andreas Bernard: Das Profil als biografische tabellarische Fassung eines Individuums hat im 20. Jahrhundert erst eine Karriere in der Psychotechnik gemacht. Es wurde erstellt, um abweichende Schüler zu untersuchen und einer Sonderschule zuzuweisen. Ab den 1960ern machte das Profil eine kriminalistische Karriere als Täterprofil. Mich hat die Frage interessiert, wie es kommt, dass dieses Format heute für Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung und aktive Selbstgestaltung steht.
Und – wie lässt sich das erklären?
Erstens gibt es einen Zusammenhang zwischen Social Media und dem Arbeitsmarkt. Die Normal-Erwerbsbiografie, wie sie in der Bundesrepublik in den 1960ern und 1970ern noch typisch war – eine Anstellung das ganze Berufsleben lang –, hat sich rasant verändert.
„Vor 30 Jahren gab es Proteste gegen die Volkszählung in Deutschland. Viele glaubten, der Staat würde den Einzelnen verfolgen. Heute stellen wir viel umfassendere Daten freiwillig ins Netz.“
Heute haben wir es mit einer Abfolge von befristeten Verträgen zu tun. Die Attraktivität der freiwilligen Profile hat sehr stark damit zu tun, dass diese Zerstückelung der Erwerbsbiografien eine Selbstprofilierung, eine ständige Selbstpräsentation als arbeitsuchende Person erfordert. Zweitens kann man fragen, warum die Paranoia vor dem Staat, der meine Daten will, dem Wunsch Platz gemacht hat, erfasst zu werden. Ich möchte auf Facebook meine Daten teilen. Ich möchte meine Daten auf dem Fitness-Armband sammeln. Ich möchte meine Position hundertmal am Tag orten. Diese Erfassungslust ist etwas Neues. Da hat sich was verschoben: Wenn der Staat früher unsere Daten wollte, hatte das etwas Gefährliches. Vor dem musste man Angst haben, er könnte uns unserer Rechte berauben.
Das haben wir im 20. Jahrhundert von den totalitären Systemen gelernt.
Richtig. Heute können Facebook, Google und Apple genauso schlimme Dinge mit deinen Daten anfangen wie der Staat. Diese Unternehmen verschwinden aber hinter den Communitys, die sie anbieten. Wenn wir heute unsere Daten ins Netz stellen, dann haben wir das Gefühl, wir tun das unter Freunden. Wir lernen die große Liebe kennen und finden verschollene Klassenkameraden wieder.
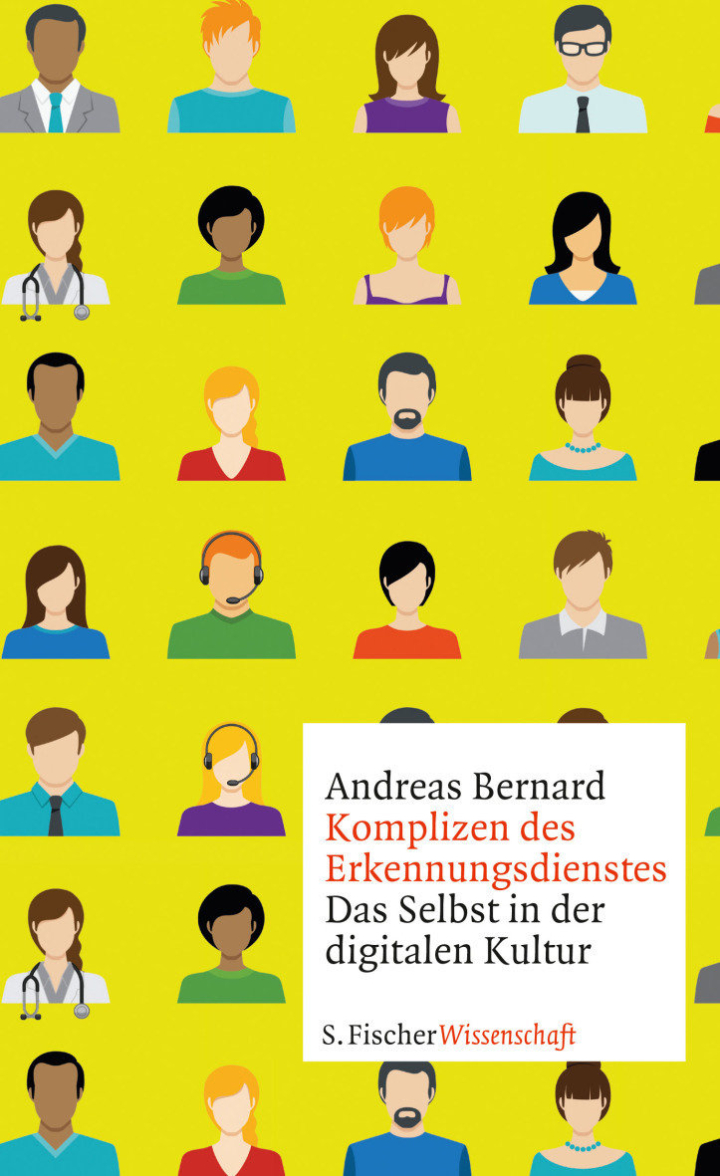
Im 19. Jahrhundert glaubten viele Wissenschaftler, durch Vermessung des Menschen könnte man auf seine angeborenen Eigenschaften schließen.
Der eine sagte, er könne an der Form des Schädels die Intelligenz messen. Der andere sagte, er könne daran den geborenen Verbrecher erkennen. Anhand der Schädelform sollte die vermeintlich niedere Intelligenz der amerikanischen Ureinwohner oder der Afrikaner festgemacht werden oder die latente „Geistesgestörtheit“ aller Arten von Verbrechern. Als im frühen 20. Jahrhundert politische Ideologien wie der Faschismus und der Nationalsozialismus die Ausgrenzung von Menschengruppen zur Politik machten, lieferten diese Theorien die wissenschaftliche Legitimation. Umso irritierender ist es, dass all diese „Vermessungswissenschaften“ heute in einer Bewegung wie „Quantified Self“ (Anm. d. Red.: Selbstvermessung über digitale Geräte) angelegt sind. Heute geht es nicht mehr darum, Kollektive auszugrenzen, sondern das eigene Selbst zu optimieren. Die Prozesse und Techniken der Vermessung sind aber sehr ähnlich.
Heute vermessen wir uns freiwillig selbst, und wir legen Profile an, um mit unseren Freunden zu kommunizieren. Wo ist das Problem?
Der Begriff der Freiwilligkeit ist zentral. Das Social-Media-Profil wird freiwillig erstellt. Das Fitness-Wearable wird freiwillig umgeschnallt. Aber was bedeutet das? Ist es eine Emanzipation von Autoritäten, oder ist es nicht eher eine vorauseilende Selbstproblematisierung?
Wir tun es, weil wir denken, dass wir es tun sollten?
Ich glaube, dass heute Prozesse der Normierung oder der Disziplinierung auf die Menschen selbst übergegangen sind. Das kann man anhand von vielen Beispielen belegen. Etwa die Pränataldiagnostik, die nach Defekten im Embryo sucht: Die führt zur Selektion von Leben, für die früher „Wissenschaften“ wie die Eugenik oder die Rassenhygiene zuständig waren. Heute entscheiden sich die Paare oder die schwangeren Frauen freiwillig für einen Schwangerschaftsabbruch, wenn es heißt, das Kind könnte mit einem Down-Syndrom geboren werden. Dasselbe gilt für die Datenströme. Vor 30 Jahren gab es Proteste gegen die Volkszählung in Deutschland. Viele glaubten, der Staat würde den Einzelnen aussaugen und verfolgen. Heute stellen wir viel umfassendere und intimere Daten freiwillig ins Netz.
Aber es verändert sich was: Apps wie Snapchat sind das Gegenteil eines Profils. Es gibt auch dort Storys, die archiviert werden, aber das meiste, das dort gepostet wird, existiert im Netzwerk sichtbar nur für kurze Zeit.
Es wäre unoriginell, diese Entwicklung nur als Verfallsgeschichte zu beschreiben. Die Generation der heute 13-Jährigen bedient diese Apps beeindruckend souverän und schreckt mit instinktiver Sicherheit vor manchem zurück. Snapchat ist ein gutes Beispiel. Diese neuen Techniken scheinen etwas zurückzunehmen, wobei man natürlich nicht weiß, inwieweit wirklich gelöscht wird. Es wird gelöscht für die Sinne der Nutzer, aber werden die Protokolle nicht doch gespeichert?
Wie haben die sozialen Medien ihre Nutzer verändert?

In den 1970er- und 1980er-Jahren galt es als eine Todsünde, sich selbst zu einer Sache zu machen. Die sozialen Netzwerke haben in den vergangenen 15 Jahren durchgesetzt, dass der marketinghafte Blick auf das eigene Selbst der absolute Standard geworden ist. Wenn ich heute ein Buch schreibe, eine Platte veröffentliche oder einen Kinofilm mache und nicht in den sozialen Netzwerken eine kleine Marketingagentur meiner selbst gründe, bin ich ein exotischer Vogel.
Man könnte aber auch sagen: Die Menschen sind realistischer geworden. Sie wissen, dass wir alle Produkte von vielfältigen Erwartungen und Vernetzungen sind.
Ich beobachte, dass sich die alte Paranoia vor der Erfassung in alle Winde zerstreut hat. Aber es gibt eine neue Angst, die man vielleicht Biografieangst nennen könnte. Die ständige Frage „Was wird mit mir, bin ich so gut wie die?“ – das ist etwas, was sich definitiv in den vergangenen Jahrzehnten geändert hat. Sich selbst mit Marketingaugen zu sehen pflanzt eine Unsicherheit in die Menschen, die zu biografischen Ängsten führt. Mein Buch versucht auch, eine Geschichte dieser Ängste zu erzählen.
Titelbild: Thomas Rabsch/laif


