„Ich wollte klarmachen, dass die Herkunftsfamilie eine Art Performance ist“
In „Dschinns“ lässt Fatma Aydemir die verdrängten Konflikte einer Familie aufbrechen. Uns hat sie erzählt, warum der Roman in den Neunzigern spielt und welche Leerstellen sie bei ihren Recherchen wahrgenommen hat

In ihrem ersten Roman „Ellbogen“ schrieb die taz-Redakteurin und Schriftstellerin Fatma Aydemir, Jahrgang 1986, über eine Deutschtürkin aus Berlin, die es nach Istanbul zieht. In ihrem zweiten Roman „Dschinns“ stirbt der Familienvater Hüseyin an seinem Sehnsuchtsort Istanbul an einem Herzinfarkt. Die Familie, einst aus den kurdischen Gebieten der Türkei als Arbeitsmigrant*innen in eine deutsche Kleinstadt gezogen, kommt für die Beerdigung zusammen. In sechs Kapiteln, in denen die Eltern und ihre vier Kinder jeweils ihre eigene Geschichte erzählen, wird klar: Die meisten ihrer Probleme hat sich die Familie verschwiegen.
fluter.de: In „Dschinns“ lässt du deine Figuren von ihren Traumata und Unsicherheiten erzählen, es geht unter anderem um Queerness, kurdische Identität, den Verlust eines Kindes und Kriegserfahrungen. Warum wolltest du all das in einer Familie bündeln?
Fatma Aydemir: Sechs Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und Identitätskonstruktionen können Teil einer Familie sein, aber ihre Herkunft unterschiedlich verorten. Dadurch dass die Eltern im Buch als Arbeitsmigrant*innen aus der Türkei nach Deutschland kamen, entsteht eine Kluft zwischen der Elterngeneration und den Kindern, jeder hat ganz unterschiedliche Ängste und Traumata. Es gibt zum Beispiel die Tochter Peri, die als Erste in der Familie studiert. Das hat zur Folge, dass sie eine andere Klassenzugehörigkeit haben wird als ihre Eltern. Es entsteht ein anderes kulturelles Kapital, wenn man bilingual in Europa aufwächst und bessere Schulen besucht, als die eigenen Eltern das konnten.
Innerhalb der Familie wird viel verschleiert und verdrängt. Es wird kaum darüber gesprochen, was die einzelnen Personen jeweils mit sich herumtragen. Gleichzeitig wird der Wert der Familie betont. Wie passt das zusammen?
Das hat mit den Klüften zu tun, von denen ich gesprochen habe. Die Familienmitglieder sind zum Beispiel mit unterschiedlichen Sprachen sozialisiert worden. Die Eltern mit Kurdisch, die älteste Tochter, Sevda, ein wenig mit Kurdisch, eher mit Türkisch. Die jüngeren Kinder sprechen nicht mal mehr gut Türkisch, sondern vor allem Deutsch. Das beeinflusst die Kommunikation untereinander. Die Beerdigung des Vaters in Istanbul zwingt dann die Familienmitglieder, miteinander Zeit zu verbringen, egal mit welchen Konflikten sie gerade beschäftigt sind. Ich wollte klarmachen, dass die Herkunftsfamilie eine Art von Performance ist und dass alle Figuren darin ihre jeweilige Rolle spielen, sich mit der aber nicht zwangsläufig wohlfühlen. Da kommt auch der Titel ins Spiel.
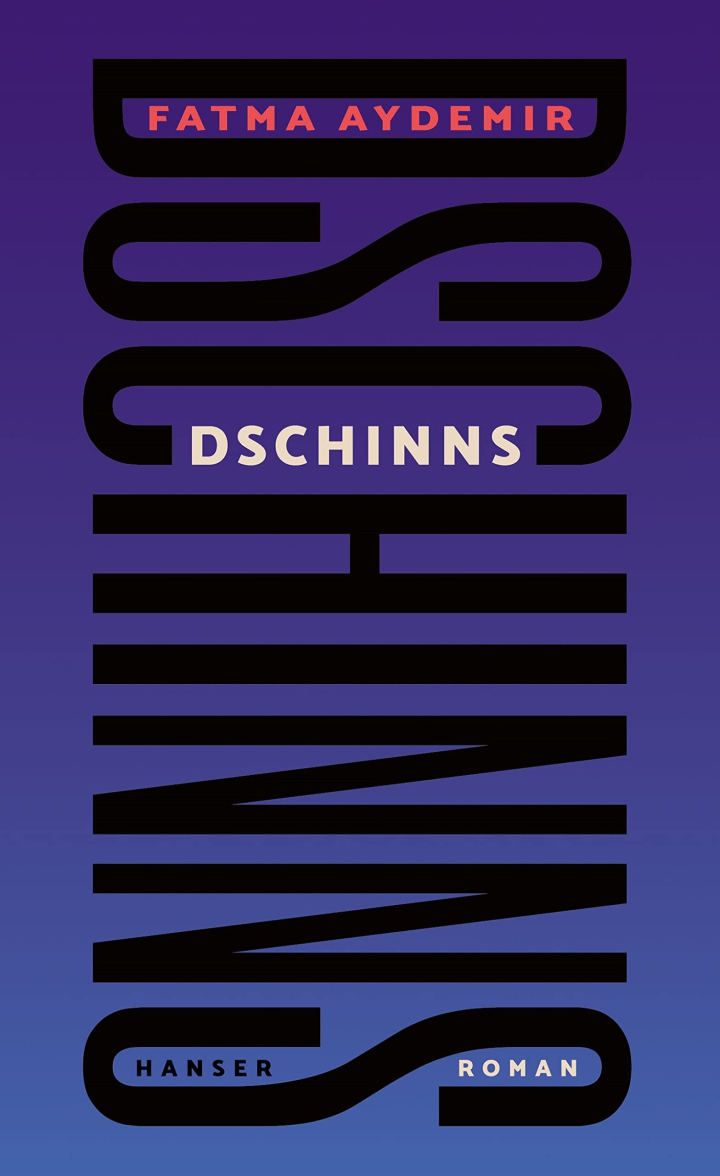
„Dschinns“ sind übersinnliche Wesen, die laut der islamischen Vorstellung Menschen beeinflussen und von ihnen Besitz ergreifen können. Wofür stehen sie bei dir?
„Dschinns“ stehen für mich für all diese Leerstellen, für das Verschleiern und Verdrängen. Es wird einerseits etwas bewusst zurückgenommen und nicht gezeigt, andererseits gibt es Dinge, mit denen sich die Personen selbst nicht konfrontieren wollen. Die Eltern nicht mit ihren Traumata, die Kinder wiederum wissen nicht, ob sie mit ihren Eltern überhaupt über ihre Probleme sprechen können. Die Eltern haben eine Erwartungshaltung gegenüber ihren Kindern, die besagt: „Ihr sollt es besser haben, ihr habt bessere Voraussetzungen in Deutschland.“ Damit geht aber auch einher, dass sich die Kinder nicht beschweren dürfen.
Hüseyin, der Vater, bleibt diffus. Seine Zeit beim türkischen Militär scheint ihn traumatisiert zu haben. Warum will er nicht darüber sprechen?
Da er als Kurde in den kurdischen Gebieten der Türkei gedient hat, kann man davon ausgehen, dass er Gewalt erfahren hat. Aber da er Soldat war, hat er in irgendeiner Form auch Gewalt ausgeübt. Die Leerstellen seiner Figur im Buch betreffen auch Leerstellen, die ich in der türkischen Geschichtsschreibung wahrnehme.
Was sind das für Leerstellen?
Die Unterdrückung von Minderheiten in der Türkei ist nicht gut dokumentiert. Es gibt die großen Massaker, beispielsweise 1937 und 1938 an den Aleviten in Dersim (Anm. d. Red.: Dabei tötete das türkische Militär in der Region, die heute offiziell Tunceli genannt wird, nach staatlichen Angaben mindestens 13.000 Menschen, andere Schätzungen gehen von weit mehr Opfern aus). Dazu wird zwar von Historiker*innen geforscht. Aber alles, was sich in der Zeit zwischen diesen größeren Massakern ereignet hat, war sehr schwer zu recherchieren während der Arbeit an meinem Buch. Die 60er-Jahre etwa, in denen Hüseyin zur Armee geht, werden in der Türkei sehr verklärt als eine Zeit, in der das Land sich eine besonders demokratische Verfassung gab. Die Frage ist aber, wie die Verfassung umgesetzt wurde. Außerdem war es eine große Herausforderung nachzuvollziehen, wie die Assimilationspolitik im Land funktionierte.
„Menschen erzählten mir, dass sie einen Schock bekamen, weil sie erst Monate oder Jahre nach ihrer Ankunft mit der deutschen Geschichte konfrontiert wurden“
Du hast im Buch vor allem das Verhältnis von Arbeitsmigrant*innen in Deutschland zur Nachfolgegeneration behandelt. Siehst du dort auch Leerstellen in der Aufarbeitung?
Ich würde nicht von Leerstellen in der Aufarbeitung sprechen, aber es gibt definitiv Umstände, die mir selbst gar nicht so sehr bewusst waren. Zum Beispiel, dass viele Arbeitsmigrant*innen, die in den Sechzigern und Siebzigern nach Deutschland kamen, überhaupt nichts vom Holocaust wussten. Deutschland war der weit entfernte Ort mit Arbeit, Geld und besseren Lebensumständen – besetzt mit positiven Dingen. In Interviews, die ich geführt habe, erzählten mir Menschen davon, dass sie einen Schock bekamen, weil sie erst Monate oder Jahre nach ihrer Ankunft mit der deutschen Geschichte konfrontiert wurden.
Warum hast du das Buch eigentlich in den 90er-Jahren verortet und nicht in der Gegenwart oder in den 70er-Jahren, als so viele Arbeitsmigrant*innen nach Deutschland kamen?
Ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen, darum waren die Neunziger für mich schon immer eine spannende Zeit. Und wer sich mit Gewalt und Anschlägen von rechts beschäftigt, merkt, dass das alles auch ein Produkt von Strukturen ist, die sich in den Neunzigern verfestigt haben. Außerdem fand ich interessant, dass das Jahrzehnt eine Art vordigitale Zeit war, in der das Internet zwar existierte, aber noch nicht für alle zugänglich war. Ich stelle mir das total schrecklich vor, gerade für Leute, die einsam gewesen sein müssen. Es war damals für queere Personen in irgendeinem Kaff doch viel schwieriger, Leute mit ähnlichen Lebensrealitäten zu finden und sich auszutauschen. Ümit, der jüngste Sohn der Familie in „Dschinns“, hat zum Beispiel niemanden, mit dem er auf Augenhöhe darüber sprechen kann, dass er sich in einen Jungen verliebt hat. Diese Form von Einsamkeit hat mich interessiert.
Titelbild: ullstein bild - Thielker
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.


