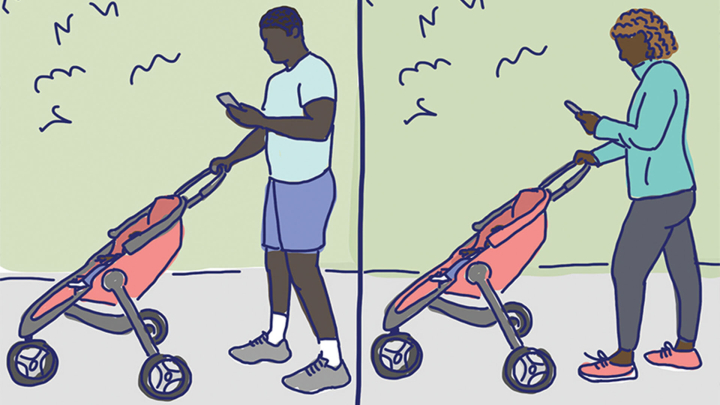Bye-bye, Boss Bitch
Frauen, die genauso knallhart Business machen wie Männer: Dafür steht der Begriff „Girlboss“. Doch leider sind die Praktiken der Chefinnen oft nicht besser als die ihrer männlichen Vorbilder. Ein Nachruf

Wir schreiben das Jahr 2014: „Nasty Gal“ – ein Onlineshop für Mode im Vintage-Look – hat gerade seinen ersten Store in Los Angeles eröffnet. Gründerin Sophia Amoruso gehört zeitweise zu den reichsten Selfmadefrauen der USA. Sie ist ein richtiger #Girlboss – eine Frau, die sich betont selbstbewusst in der männerdominierten Businesswelt behauptet und mit ähnlichen Mitteln wie die männlichen Mitstreiter Karriere macht.
„Girlboss“, „Boss Babe“ oder „Boss Bitch“ – es sind neue Vokabeln, die Frauen aufrufen, auf dem Weg zur Spitze dem Patriarchat zu trotzen. Gefragt sind knallharte Businessfrauen nach Hollywoodvorbildern wie Meryl Streep als Miranda Priestly in „Der Teufel trägt Prada“ oder Real-Life-Vorbildern wie der damals Noch-Yahoo-Chefin Marissa Mayer. 2014 erscheint Amorusos Biografie. Ihr Titel, man ahnt es vielleicht: „Girlboss“. Frauen wie Amoruso stehen in dieser Zeit für ein populäres emanzipatorisches Versprechen: Befreiung durch Erfolg.
Doch ab 2015 bekommt die feministische Fassade Risse: Ehemalige Angestellte von Nasty Gal berichten, ihnen sei widerrechtlich gekündigt worden, als sie schwanger wurden, Elternzeit nehmen wollten oder gesundheitliche Probleme hatten. Das Arbeitsklima wird als „toxisch“ beschrieben: Es ist von Ungleichbehandlung, Ellbogenmentalität oder unfairer Bezahlung die Rede.
2016 meldet Nasty Gal dann Insolvenz an – und das Ende nährt die Zweifel am Girlboss-Versprechen: Wie feministisch ist es, wenn eine Frau an ihrem persönlichen Erfolg arbeitet und dabei ausbeuterische Methoden genauso wenig hinterfragt wie die Männer, die vor ihr in der Position waren? Profitieren automatisch alle Frauen davon, wenn es eine von ihnen an die Spitze schafft? Diese Fragen werden drängender, als immer mehr Enthüllungen über selbst ernannte feministische Unternehmen die Runde machen, in denen Angestellte schlecht behandelt werden. Sie scheinen sich zu beantworten, als auch im Feminismus mehr darüber diskutiert wird, welche Rollen Rassismus oder Klassismus bei Ungleichbehandlung spielen.
Der Girlboss-Feminismus vertuscht die strukturellen Probleme des Kapitalismus
Denn es wird klar: Der Girlboss-Feminismus vertuscht strukturelle Probleme. Seine Message: Wer sich anstrengt, kann es auch als Frau schaffen. Wer es nicht schafft, strengt sich wohl einfach nicht genug an. Dass auch Privilegien wie weiße Hautfarbe oder ein wohlhabendes und/oder bildungsnahes Elternhaus zum Erfolg der Girlbosse beigetragen haben könnten, wurde in der Girlboss-Ära übersehen. Ebenso, dass auch der Erfolg einzelner Frauen meist auf der Ausbeutung anderer aufbaut, die mit weniger Privilegien ausgestattet sind: Sei es die Näherin in Bangladesch, die das „Girlboss“-Shirt zusammennäht, oder die Praktikantin, die 50 Stunden in der Woche unbezahlt schuftet.
Auf Social Media wird der Girlboss-Begriff heute, nach seiner Entzauberung, zunehmend zur Beschreibung der Methode genutzt, kapitalistische Interessen mit dem hohlen Versprechen von feministischem Empowerment zu schmücken. In Bezug auf den vielleicht beliebtesten und plattesten Wandtattoo-Spruch der Geschichte – „live, laugh, love“ – entsteht dann 2021 der Ausdruck „gaslight, gatekeep, girlboss“. Ein Meme, das das Girlbossing in eine Reihe mit anderen ausbeuterischen und manipulativen Methoden stellt und endgültig klarmacht: Die Girlboss-Ära ist vorbei. Bye-bye, Boss Bitch.
Aber weil man über Verflossene nicht nur schlecht reden soll: Ihren Zweck hatte sie trotzdem. Dank ihr rückt der Kapitalismus mehr in den Fokus feministischer Kämpfe, denn es ist nun klar: Einzelne Frauen in Machtpositionen bieten keine Lösung für systemische Probleme. Feminismus scheint sich nun mehr und mehr von Karrierefantasien abzuwenden und sich stattdessen dem großen Ganzen zu widmen: Es geht nunmehr darum, das System grundlegend zu verändern, statt es nur hier und da für Einzelpersonen nutzbar zu machen. Also: Danke für den Impuls, lieber(!) Girlboss.
Titelbild: David Häuser
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.