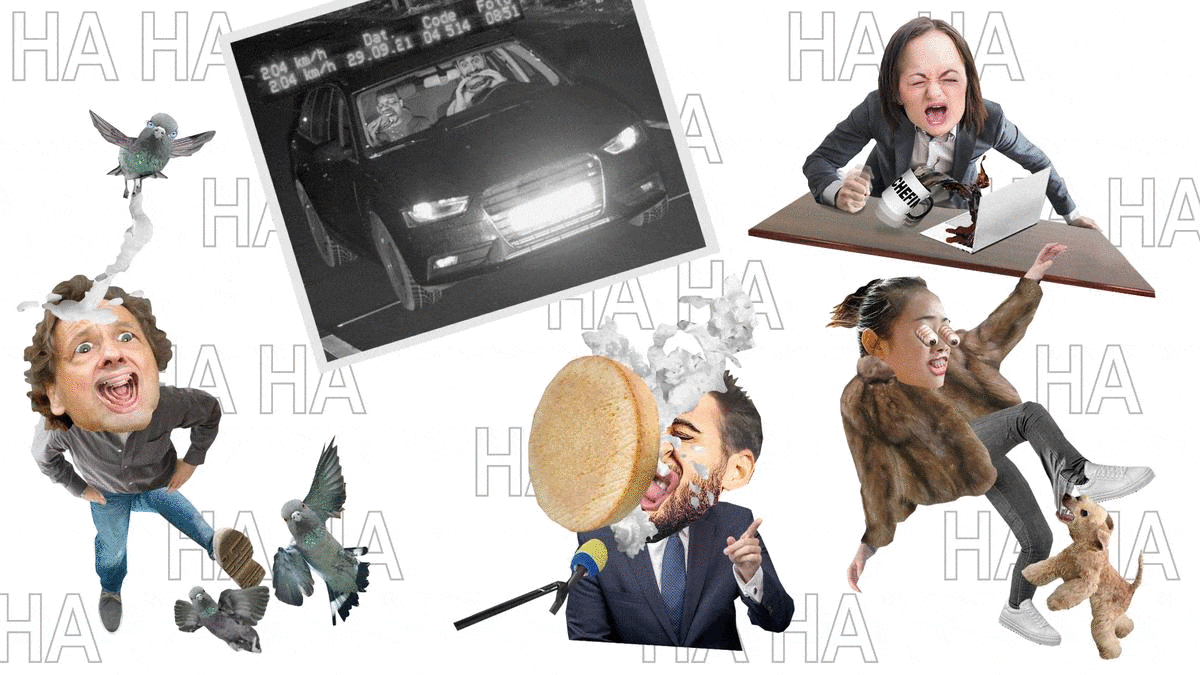„Vielleicht müssten wir Humor als Schulfach einführen“
Die Comedy-Autorin und Podcasterin Giulia Becker hat ihr zweites Buch veröffentlicht. Ein Gespräch über Witze mit sozialer Intelligenz und darüber, dass „Drinnie“-Sein kein Tabu mehr ist

Giulia Becker, geboren 1991, arbeitete für das Autor:innenteam von Jan Böhmermanns „Neo Magazin Royale“, als Drehbuchautorin für die ZDF-Sitcom „Ruby“ und tritt regelmäßig mit ihren Sketchen in der „Carolin Kebekus Show“ auf. Zusammen mit dem Autor Chris Sommer hostet sie den Podcast „Drinnies“. 2019 erschien ihr Debütroman „Das Leben ist eins der Härtesten“. Ihr zweites Buch „Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes“ ist eine Sammlung von Kurzgeschichten über skurrile Situationen und die Herausforderungen des täglichen Lebens.
fluter.de: Dein neues Buch ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Im ersten Kapitel denkt die Ich-Erzählerin über ihre eigene Beerdigung nach. Danach geht es ums Ausmisten, gefolgt von einem Selbsttest: „Bin ich ein potenzieller Serienmörder?“. Wie kam es zu diesem Buchkonzept?
Giulia Becker: Das ist ein bisschen aus der Not heraus entstanden, weil ich selbst Probleme habe, bei längeren Texten dranzubleiben. Seit es das sogenannte Internet gibt, stecke ich in einer andauernden Lesekrise. Deshalb habe ich vor ein paar Jahren Kurzgeschichtenbände für mich entdeckt. Ich habe die Bücher von Ella Carina Werner, Fran Leibowitz und Demetri Martin verschlungen. Und ganz schnell gemerkt: Genau das will ich auch machen. Mir gefällt an der Form, dass ich einfach machen kann, was ich lustig finde und von dem ich glaube, dass es andere zum Lachen oder auf gute Gedanken bringt.
Manche deiner Kolleg:innen machen Witze auf Kosten anderer, zuletzt zum Beispiel Luke Mockridge über Menschen mit Behinderung. Wie blickst du auf diese Art Comedy?
Ich sehe ja, was Humor alles kann, und dann schaffen es trotzdem die billigsten und menschenverachtendsten Witze, die noch dazu schon hundertfach gemacht worden sind, in die Öffentlichkeit, das finde ich frustrierend. Die humoristische Bildung in Deutschland ist auf einem schlimmen Stand. Vielleicht müssten wir Humor als Schulfach einführen, damit die Leute ein bisschen anspruchsvoller werden in ihrem Lachen. Ich meine damit nicht hochtrabende intellektuelle Witze, die mache ich selber nicht. Soziale Intelligenz würde auch schon helfen.
„Ich sehe, was Humor alles kann, und trotzdem schaffen es die menschenverachtendsten Witze in die Öffentlichkeit. Das frustiert mich“
In deinen Büchern machst du dich nicht über Menschen lustig, sondern teilst einen liebevollen Blick auf die Figuren, ihre Sorgen und ihr Scheitern.
Ich mache mich schon auch mal gerne über neoliberale Berlin-Mitte-Spießer mit fünfstelligem Monatseinkommen und Ozempic-Leibarzt lustig, aber grundsätzlich versuche ich, Comedy woanders zu suchen. Am Ende des Tages sind die auch einfach sehr langweilig. Ich liebe das Absurde. Ich muss niemanden durch den Kakao ziehen, mein Humor braucht das nicht. Ich mache Quatsch, und ich bin auch einfach Fan von Quatsch. Es geht doch nichts über einen zünftigen Jux.
Im Buch geht es auch um Konsum, den du einerseits faszinierend findest, andererseits kritisierst. Zara, schreibst du, sei das „Modegeschäft für alle, die schon mal wissen wollten, wie es sich anfühlt, wenn einem nicht mal ein Schal passt“.
Modegeschäfte sind der Staatsfeind Nummer eins von mir und wahrscheinlich allen dicken Personen. Wenn ich Kleider kaufen möchte, finde ich in der Stadt keinen einzigen Laden, der meine Größe hat. Es gab mal eine Zeit, als es bei H&M noch große Größen gab, aber die wollen jetzt dicke Menschen wohl gar nicht mehr im Geschäft haben. Natürlich musste ich mich im Buch deswegen auch an deutschen Innenstädten abarbeiten.

Dein Markenzeichen ist ein komischer Blick auf tragische Situationen. Hattest du den schon immer?
Ich habe schon immer versucht, auch über blöde Dinge zu lachen, das Leben nicht ganz zu ernst zu nehmen. Diesen lustigen Blick aufs Leben habe ich mir von meiner Oma abgeguckt. Sie konnte schon immer, wenn ihr ein Missgeschick passiert ist, wirklich herzlich darüber lachen. Humor hilft, die Schwere aus einer Situation rauszunehmen.
Hilft er auch angesichts der Weltlage?
Es ist jetzt nicht so, dass ich Witze über den Nahostkonflikt mache und mich danach besser fühle. Doomscrolling kenne ich gut, ich konsumiere sehr viele Nachrichten, manchmal zu viel. Was mir hilft, sind Inseln, auf denen ich ohne Reue mal alles vergessen kann. Wenn ich merke, es wird mir zu viel und ich komme in eine Abwärtsspirale, gucke ich zum Beispiel eine Folge „Das perfekte Dinner“, in der ein Kandidat als Nachtisch Vanillepudding mit Krabben serviert, dann geht’s wieder. Oder ich begebe mich auf YouTube oder Wikipedia in irgendein thematisches Rabbit Hole, um mich ein bisschen abzulenken.
Eine Auszeit vom Weltschmerz ist auch der „Drinnies“-Podcast, den du im ersten Corona-Winter mit deinem Partner, dem Comedy-Autor Chris Sommer, gestartet hast. Was sind eigentlich „Drinnies“?
Das sind eher introvertierte Personen, die sich nicht mit Leuten treffen müssen, um ihre sozialen Batterien aufzuladen, sondern im Gegenteil dafür eher Zeit alleine brauchen. Damit können wir uns beide identifizieren.
Wann hast du gemerkt, dass du ein „Drinnie“ bist?
Ich habe schon in der Schule gemerkt, dass ich anders bin, auch als meine Freundinnen. Mit ihnen habe ich mich wohlgefühlt, aber danach Zeit allein gebraucht. Es fällt mir schwer, auf fremde Menschen zuzugehen, und ich mag keinen Small Talk. Irgendwann habe ich beschlossen, dass das nun mal meine Charaktereigenschaft ist. Und dass ich mir das Leben nicht unnötig schwer mache, indem ich mich zu sozialen Interaktionen zwinge, auf die ich keine Lust habe.
„Für unseren Podcast bekommen wir wöchentlich E-Mails von Leuten, die sagen, sie haben nun endlich ein Wort für das, was sie sind: Drinnies“
Früher war es fast ein Tabu zu sagen, dass man lieber für sich ist oder nach sozialem Stress eine Pause braucht. Man könnte sagen, euer Podcast hat geholfen, das „Drinnie“-Sein zu entstigmatisieren.
Das war nicht geplant, wir machen ja einen Comedy-Podcast. Aber wir freuen uns natürlich, wenn das so ist. Wir dachten am Anfang, das wird ein Nischen-Podcast, und dann hat sich das verselbstständigt. Bis heute bekommen wir wöchentlich E-Mails von Leuten, die sagen, sie haben endlich ein Wort dafür. Nachdem wir in der Talkshow „Kölner Treff“ zu Gast waren, hat sich eine Frau bei uns gemeldet, die über 90 war. Sie schrieb, dass sie nach der Sendung den Podcast gehört und gemerkt habe, dass sie ein „Drinnie“ sei. Für uns ist es ja heute schon krass, dass man als Couch-Potato und Freak gelabelt wird, wenn man lieber mal alleine ist und nicht immer mit anderen abhängen will, aber wie das vor 80 Jahren war, mag ich mir gar nicht vorstellen. Schön ist auch, wenn sich Jugendliche melden, sogar Achtjährige, die ganz stolz sagen, dass sie „Drinnies“ sind.
Gerade in der Schulzeit will man ja nicht auffallen oder anders sein.
Hätte ich mit 13, 14 Jahren jemanden gehabt, der mir sagt, das ist nicht uncool, sondern vielleicht sogar ganz cool, dass ich so bin, wäre mir wahrscheinlich eine Menge erspart geblieben. Eigentlich wollen wir „nur“ unterhalten, aber dass das bei so vielen Leuten so viel ausgelöst hat, ist ein toller Nebeneffekt.
Foto: Frederike Wetzels
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.