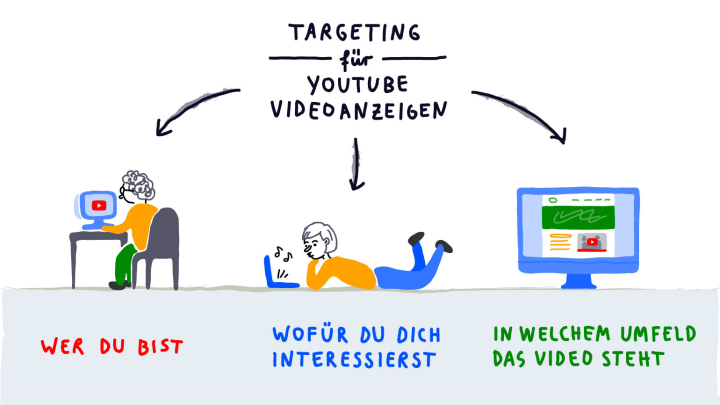Sollten wir im Netz anonym sein?
Immer öfter hört man die Forderung, dass Plattformen unsere Klarnamen kennen müssen. Wäre es das Ende von Hate Speech oder ein Angriff auf die Rückzugsräume des Netzes? Unsere Autoren sind uneins

Ja! Anonymität tut weh. Aber wir müssen sie aushalten
findet Eike Kühl
Nun also Österreich. Die ohnehin gebeutelte Regierung unseres Nachbarn plant ein Gesetz, das die Anonymität im Internet einschränkt. Plattformen mit mehr als 100.000 Nutzern oder mehr als 500.000 Euro Jahresumsatz, also etwa Facebook, Instagram oder YouTube, aber auch Nachrichtenseiten und Foren, sollen die Identität ihrer Nutzer*innen überprüfen und deren Klarnamen und Anschrift speichern. „Digitales Vermummungsverbot“ heißt das. 2011 kam Bundesinnenminister Friedrich auf die Idee, kürzlich forderte auch Bundestagspräsident Schäuble die Klarnamenpflicht. Die Idee war damals wie heute nicht gut.
Natürlich sind Hass und Hetze gerade in sozialen Netzwerken und Kommentarspalten ein Problem. Der Ton im Netz überschreitet oft die Grenzen der Netiquette, manchmal auch die des Gesetzes. Auch ich habe schon anonyme Leserpost erhalten, die mir, um es dezent auszudrücken, nicht gerade Lebensfreude und Gesundheit gewünscht hat. Trotzdem möchte ich künftig nicht meinen Ausweis vorlegen müssen, wenn ich mich auf einer Website registriere. Eine Klarnamenpflicht ist kein Allheilmittel gegen Trolle, sie betrifft vor allem Unschuldige.
Als würde man in der Kneipe den Perso abgeben – und erlauben, dass der Wirt alle Gespräche aufzeichnet
Anonymität und Pseudonymität sind ein Schutz. Auch wenn es manchmal wehtut: Eine demokratische Gesellschaft muss das aushalten. Viele demokratische Prozesse laufen aus gutem Grund anonym ab. Wir wählen geheim und können demonstrieren, ohne unsere Identität preiszugeben. Dasselbe gilt im Netz: Nicht nur Whistleblower*innen und Dissidenten genießen den Schutz der Anonymität. Auch Menschen, die sich in Foren über ihre Zweifel austauschen, über sexuelle Vorlieben, ihre Lieblingsband oder das Weltgeschehen, können ihren Klarnamen für sich behalten.
Ohne diesen Schutz wären Diskussionen im Netz vermutlich deutlich ruhiger. Denn eine Klarnamenpflicht im Internet wäre nichts anderes als die Pflicht, beim Betreten einer Kneipe dem Wirt seinen Personalausweis und die Erlaubnis geben zu müssen, alle Gespräche am Tisch aufzunehmen, wie ein Kollege mal beschrieb. Selbst wenn uns nur die Wirte und nicht die Gäste namentlich kennen: Wer diese Vorstellung nicht unbehaglich findet, bestelle das erste Bier.
Datendiebstahl ist bei einer Klarnamenpflicht unumgänglich
Eine Klarnamenpflicht würde das Recht auf informelle Selbstbestimmung beschneiden. Sie widerspricht den Vorgaben der DSGVO, nach denen die Plattformen weniger persönliche Daten erheben und speichern sollen. Und sie schafft neue Anreize für Hacker: Wenn schon Facebook Nutzerdaten nicht richtig sichern kann, wie sollen es kleine Anbieter können? Selbst wenn ein Klarnamenzwang vorerst nur große Dienste und Plattformen beträfe: Erfahrungsgemäß werden Überwachungsgesetze mit der Zeit eher ausgeweitet als entschärft.
Statt dem Internet die Anonymität auszutreiben, sollten sich Politik und Behörden lieber überlegen, wie sie die gegebenen Möglichkeiten der Strafverfolgung verbessern können. Es gibt auch ohne Ausweispflicht die Möglichkeit, Nutzer zu identifizieren, etwa über IP-Adressen. Die kann man natürlich verschleiern, aber wer wirklich anonym bleiben möchte, wird das so oder so tun. Das Problem ist weniger die Identifizierung der Täter als vielmehr mangelnde Bereitschaft und Mittel aufseiten der Strafverfolger, Bedrohungen und strafbare Beleidigungen im Netz konsequent zu verfolgen. Man könne da nicht viel tun, bekommen Opfer oft zu hören.
Ein Klarnamenzwang wird daran nichts ändern. Er wird auch nicht dafür sorgen, dass in den sozialen Netzwerken plötzlich Friede herrscht. Das zeigt ein Beispiel aus Südkorea. 2007 gab es dort eine Identifizierungspflicht für die Nutzer großer Plattformen. Im ersten Jahr ging die Anzahl der Hasskommentare einer Studie zufolge trotzdem nur um 0,9 Prozent zurück, 2012 wurde das Gesetz vom südkoreanischen Verfassungsgericht wieder gekippt. Zuvor waren allein in einem Angriff auf ein soziales Netzwerk 35 Millionen Datensätze mit persönlichen Informationen gestohlen worden.
Die Südkoreaner zahlten einen hohen Preis für wenig Ertrag. Wir können uns das sparen.
Nein! Diskussion braucht Verantwortung, keine Anonymität
entgegnet Daniel Mack
Mit dem jüngsten Rechtsruck haben sich soziale Netzwerke verändert. Es ist hart, was dort innerhalb von Minuten an Hetze, Hass und Gewaltaufrufen zusammenkommen kann. Und es hat System: Schaut man sich die Profile von Dunja Hayali oder Cem Özdemir an, fallen vor allem anonymisierte User durch Hate Speech auf.
Ich frage mich, was das für unsere Demokratie bedeutet. Was das mit denen macht, die sich für unsere Gesellschaft engagieren. Egal ob sie das ehrenamtlich oder hauptberuflich tun.
Wird der Druck so groß, dass Menschen ihr Engagement beenden? Oder es aufgrund der Erfahrungen anderer erst gar nicht aufnehmen?
Eine Debatte funktioniert nur mit Namen und Gesicht – ob im Bierzelt oder im Netz
Kommunikation lebt von persönlicher Verantwortung, das habe ich schon als Jugendlicher gelernt. Wer veröffentlicht, sollte auf das Plakat oder die Zeitung mindestens einen Namen schreiben: Daniel Mack, V.i.S.d.P. – Verantwortlich im Sinne des Presserechts.
Ich verhalte mich heute nicht anders, wenn ich persönlich kommuniziere. Ob Twitter oder offline: Ich nenne meinen Namen und zeige mein Gesicht oder eben ein Bild, auf dem man mich klar erkennt.
Im Netz machen das viele Diskutanten anders. Ihre Profile firmieren unter Fantasienamen oder wirr aneinandergereihten Zahlen und Buchstaben, ihre Profilbilder zeigen alles, Legofiguren, Schäferhunde, Putin, nur nicht sie selbst. Dass manche sich verkleiden oder irgendwo austoben wollen, kann ich nachvollziehen. Sie sollen aber bitte zum Karneval oder Sport gehen. Eine politische Debatte funktioniert meines Erachtens nur mit Namen und Gesicht. Ob im Bierzelt oder im Netz.
Ob der Klarname sichtbar ist, soll jede*r für sich entscheiden dürfen
Wir müssen deshalb aufpassen, dass die digitale nicht über die analoge Welt bestimmt. Wenn die Anzahl und die Intensität von Beleidigungen und Drohungen zunehmen, wenn sie nicht von Einzelnen stammen, sondern von Gruppen geplant und gesteuert werden, können wir schlecht die Anonymität hochhalten. Bei einem Vergehen in der echten Welt werden auch die Personalien aufgenommen. Argumente für das anonyme Netz lese ich trotzdem seit Jahren. Überzeugend finde ich sie nicht.
Ob der Klarname im Profil sichtbar ist, sollte jeder Nutzer für sich selbst entscheiden können. Die Betreiber der Plattform aber sollten ihn kennen. Das würde ich gesetzlich vorschreiben, denn es ist schnell gemacht: per Postident-Verfahren oder mit einer Mehr-Faktor-Authentifizierung, die neben dem Klarnamen auch eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer voraussetzt, an die dann ein Anmeldecode geschickt wird. Airbnb setzt solche Maßnahmen bereits um.
Nur mit einem klaren Regelwerk können wir die Digitalisierung zur Stärkung unserer Demokratie nutzen
Klar ist auch, dass diese Identifizierungsdaten sicher und getrennt von sonstigen Nutzerdaten gespeichert werden müssen. Hat eine Ermittlungsbehörde hinreichende Gründe für einen Gesetzesverstoß eines Nutzers, kann die Plattform dessen Daten dann auf richterliche Anordnung herausgeben.
Das ist zum Besten aller: In einer offenen Gesellschaft sind wir am sichersten, wenn Polizei oder Verfassungsschutz Informationen nahtlos austauschen können. Nur mit einem klaren Regelwerk und Kontrollen können wir die Digitalisierung zur Stärkung unserer Demokratie nutzen. Sonst tritt das Gegenteil ein.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.