Im Namen des Volkes
Vor dem Gesetz sind alle gleich – sofern sie ihre Rechte kennen, verstehen und einen Anwalt bezahlen können. In sogenannten Law Clinics beraten Jura-Studierende ehrenamtlich Rechtsuchende
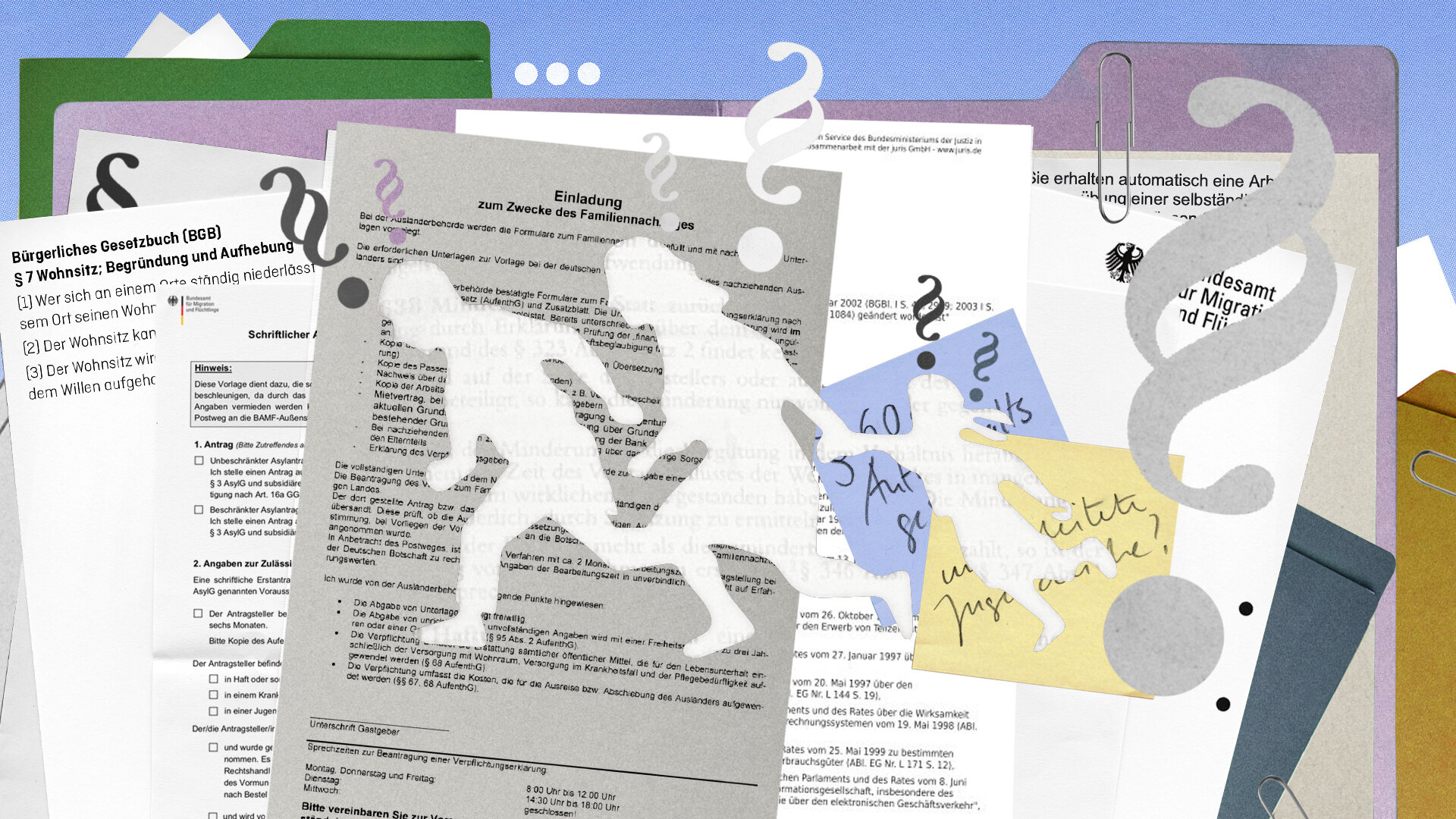
Manchmal kann Hannah den Menschen, die bei ihr Rat suchen, die Lage selbst nicht erklären: So kompliziert sind einige deutsche Rechte. Da war zum Beispiel Adil* aus Syrien.
Er hat einen deutschen Pass, lebt seit Jahren in Deutschland und wollte seinen 19-jährigen Bruder Dayan* nachholen. Adil hatte vom Familiennachzug gehört. Aber der gilt in seinem Fall nur für Ehepartner und (eigene) minderjährige Kinder – nicht für kleine Brüder. Dayan könnte als Kriegsdienstverweigerer in Syrien politische Verfolgung drohen. Aber damit die deutschen Behörden das überhaupt prüfen können, hätte Dayan in Deutschland sein müssen, um einen Asylantrag zu stellen. Und einen legalen Weg, Dayan nach Deutschland zu holen, gab es nicht. Bei der Ausländerbehörde konnte man Adil nicht helfen. Welche Chance hatte sein Bruder noch? Eine Beratungsstelle für Geflüchtete empfahl Adil die Law Clinic Münster (LCM). Dort arbeiten Jura-Studierende ehrenamtlich.
Mehr als 80 Fälle hat die Law Clinic Münster vergangenes Jahr bearbeitet, 15 musste sie ablehnen
Sie beraten Menschen wie Adil, die nicht mehr wissen, an wen sie sich wenden sollen, die sich nicht trauen, sich an staatliche Stellen zu wenden, oder denen das Geld für einen Anwalt fehlt, erzählt Hannah. Sie studiert im sechsten Semester, nahm sich Adils Fall gemeinsam mit einer Teamkollegin vor. Tatsächlich entdeckten sie noch eine Möglichkeit: Würde Adil etwa nach Brandenburg umziehen, könnte das neue rechtliche Möglichkeiten für Dayan eröffnen. Einige Bundesländer haben spezielle Aufnahmeprogramme für Syrer, die den Familiennachzug für Geschwister, Enkel oder Großeltern vorsehen.
Allerdings hätte Adil Auflagen erfüllen müssen: Sein „Lebensmittelpunkt“, wie es in der Landesaufnahmeordnung heißt, müsste beispielsweise seit mindestens einem Jahr in Brandenburg liegen. „Für Adil“, sagt Hannah, „wäre das ein langfristiger Umzug ins Unbekannte gewesen – ohne Garantie, dass Dayan dann wirklich kommen darf.“ Denn ob die Bedingungen als erfüllt angesehen werden, läge im Ermessen der Behörde.
Hannah schüttelt den Kopf, als sie Adils Geschichte erzählt. Sie sitzt in einem kleinen Raum im Dachgeschoss der Jura-Fakultät der Universität Münster, dem Treffpunkt des Law-Clinic-Teams. Hinter ihr stehen leere Bier- und Limokästen, daneben ein kleiner Kühlschrank. Die Abende in der LCM können schon mal länger werden. An der Wand hängen Fotos vom jährlichen Teamausflug. Mehr als 40 Menschen lächeln in die Kamera. Die Münsteraner Law Clinic ist eine der größeren in Deutschland. „Manchmal beschäftigen wir uns wochenlang mit einem Fall, sind in engem Kontakt mit den Betroffenen, besuchen sie sogar zu Hause“, erzählt Hannah. Die Law Clinic arbeitet mit Hilfsorganisationen zusammen, die Menschen an sie vermitteln.
Die meisten Fälle sind aus dem Sozial- oder Asylrecht
Vielen fehle es an Geld oder Sprachkenntnissen, um den Rechtsweg zu gehen, erzählt Hannah. Manche schämen sich, dass sie selbst nicht weiterwissen, manche wissen gar nicht, dass eine Rechtsberatung gerade sinnvoll wäre, wieder andere trauen sich nicht zu einer Behörde, weil die seit Jahren ihre Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert hat. Dazu kommt, dass sich nur wenige Anwältinnen und Anwälte auf Migrationsrecht spezialisieren – zu wenige auf jeden Fall, um den hohen Bedarf zu decken.
Law Clinics gibt es an vielen deutschen Universitäten. In der Realität, sagt Hannah, brauche es aber oft eine Portion Glück, damit die Menschen die Law Clinics überhaupt finden – und damit die den Fall dann auch annehmen. Die Clinics dürfen nicht alles, es gibt klare Regeln, die teils im Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) festgehalten sind. Die Studierenden dürfen zum Beispiel niemanden vor Gericht vertreten, sondern nur außergerichtlich beraten. Laut RDG muss immer eine voll ausgebildete Juristin oder ein Jurist die Beratung „anleiten“, also bei Fragen bereitstehen und helfen. Der Fall darf in der Regel nicht strafrechtlich relevant sein. Und die Beratung darf nichts kosten. Viele Law Clinics legen zusätzlich eine Obergrenze für den Streitwert fest. In Münster liegt die bei 5.000 Euro.
„Vor der Beratung prüfen wir also immer, ob wir den Fall überhaupt annehmen können“, sagt Albert. Er ist ein Kommilitone von Hannah und berät ebenfalls in der LCM. Die Nachfrage ist groß: Mehr als 80 Fälle hat allein die Gruppe aus Münster vergangenes Jahr bearbeitet, 15 musste sie ablehnen. Die meisten Fälle kamen aus dem Sozialrecht – Fragen zum Bürger- oder Elterngeld oder Auseinandersetzungen mit dem Arbeitsamt – und dem Asylrecht: Bei der LCM geht es oft um drohende Abschiebungen, die Arbeitserlaubnis oder eben einen Familiennachzug.
Eigentlich hat die Justiz hierzulande einen guten Ruf: Die Organisation World Justice Project zählt Deutschland zu den führenden Ländern, was Rechtsstaatlichkeit angeht, unter 140 untersuchten Staaten belegt die Bundesrepublik den sechsten Platz.
Die Lücke zwischen „law on paper“ und „law in action“
Solche Statistiken können täuschen, sagt Michael Wrase. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Stiftung Universität Hildesheim, ein Schwerpunkt seiner Forschung ist der Zugang zum Recht. Dass der deutsche Rechtsstaat zu funktionieren scheint, die Law Clinics aber trotzdem gut zu tun haben, erklärt Wrase mit einer Lücke zwischen dem „law on paper“ und dem „law in action“: Von außen sieht das Rechtssystem gut aus, denn theoretisch stehen allen die gleichen Rechtswege offen. Ob aber auch in der Praxis alle zu ihrem Recht kommen, dazu gebe es kaum Daten, sagt Wrase. „Wir wissen einfach nicht, wie groß die Probleme in Deutschland sind.“ Andere Länder seien da fortschrittlicher.
Wrase untersucht gerade mit einer Forschungsgruppe am Beispiel Berlins, wie es um den Zugang zum eigenen Recht steht. Das Team durchforstet Tausende Fälle aus dem Miet- und Verbraucherrecht, führt Interviews mit Mitgliedern des Justizapparates und Hilfsorganisationen, erzählt Wrase. Ein erster Zwischenbericht liegt vor. Er gibt Hinweise, dass es für arme und zugewanderte Menschen schwerer ist, ihre Rechte wahrzunehmen. Ob man Recht bekommt, hängt laut Wrase auch von Einkommen und Herkunft ab. Rechtsschutzversicherungen oder staatliche Angebote wie Beratungsstellen oder Prozesskostenhilfe seien dagegen keine Allheilmittel.
Wer zum Beispiel Prozesskostenhilfe braucht, weil er sich die Gerichts- und Anwaltskosten nicht leisten kann, muss einen Antrag stellen. Dazu muss man schon vorher belegen, dass eine gewisse Chance auf Erfolg besteht, und im zuständigen Zivilgericht den Antrag ausfüllen. Der sei aufwendig, sagt Wrase, und so kompliziert, dass man schon beim Ausfüllen die Hilfe eines Anwalts oder einer Anwältin bräuchte. „Wenn man kein Deutsch spricht, ist das kaum zu schaffen.“ Übersetzungen gebe es keine, sagt Wrase.
„Ein Staat, der nicht glaubhaft alle gleich schützt,
riskiert seine Legitimität“
Für Hannah und Albert von der LCM ist ein weiterer Punkt entscheidend. „Im Jurastudium lernen wir, dass Gesetze vor staatlicher Willkür schützen. Wir sprechen immer von Ansprüchen und Abwehrrechten“, sagt Albert. Für die Menschen, die zu ihnen kommen, seien Gesetze aber oft genau das Gegenteil. „Sie wollen am liebsten so wenig wie möglich mit dem Staat zu tun haben“, sagt Albert. Langfristig sei das auch für die Demokratie gefährlich, sagt Hannah: „Ein Staat, der nicht glaubhaft alle gleich schützt, riskiert seine Legitimität.“
Adil und Dayan konnte sie am Ende nicht helfen. Gerade lebt Dayan mit einem Touristenvisum in einem Golfstaat. „Menschen wie Dayan, die eigentlich gute Chancen auf eine Aufenthaltserlaubnis haben, kommen oft gar nicht bis hierher“, sagt Hannah. Die Behörden würden ihnen kaum Besuchervisa ausschreiben, weil sie davon ausgehen, dass die „Rückkehrbereitschaft“ fehlt.
Die rechtliche Lage erklären – und die Motivation des Staats dahinter: Mehr können Hannah und Albert oft nicht tun. Das kann unbefriedigend sein. Und trotzdem wichtig, sagt Albert. „Schlechte Nachrichten sind leichter zu akzeptieren, wenn man wenigstens die Gründe versteht.“
* Namen geändert
Illustration: Bureau Chateau / Jannis Pätzold
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.

