Dein Spickzettel für Corona-Diskussionen
Das Thema Corona wird dieses Jahr in vielen Familien unterm Weihnachtsbaum liegen. Wie diskutiert man am besten mit Impfgegnern und Corona-Leugnern? Fünf Experten geben Tipps

Der Opa möchte sich nicht impfen lassen, die Tante hält das Virus für erfunden, und der Cousin stöhnt bei jedem Stoßlüften: Das Thema Corona wird dieses Jahr in vielen Familien unterm Weihnachtsbaum liegen oder das Videotreffen dominieren – und für Diskussionen sorgen. Fünf Expertinnen und Experten geben persönliche Tipps, wie man gut durch die Gespräche kommt.
„Der Corona-Impfstoff ist gefährlich“
Psychologe Dr. Philipp Schmid:
„Dinge zu hinterfragen ist für eine informierte Entscheidungsfindung wesentlich. Ich würde erstmal die Gefühlswelt des Gegenübers verstehen und anerkennen: ‚Wie kommst du zu dem Schluss, dass die Impfung nicht sicher ist?‘ Erst bei solchen offenen Fragen bringt der andere sich ein. Wenn er dann von dieser Webseite und jenem Telegram-Channel erzählt, würde ich sagen: ‚Stimmt, hätte ich diese Informationen gelesen, wäre ich zum selben Schluss gekommen.‘ Danach würde ich anbieten, meine Sicht mit ihm zu teilen, und auch betonen, dass die Impfung am Ende eine freie Entscheidung ist.
Oft sagen Impfskeptiker, dass sie sich erst impfen lassen, wenn der Impfstoff zu 100 Prozent sicher ist. Dieses Argument kann man auf zwei Arten widerlegen. Inhaltlich: Das Risiko der Krankheit ist deutlich höher als das Risiko einer Impfung. Rhetorisch: Hier wird eine unmögliche Erwartung gestellt, da kein medizinisches Mittel, ob Herz-OP oder Schmerzmittel, jemals absolute Sicherheit garantiert.

Viele Menschen haben Angst, weil der Zulassungsprozess so schnell abläuft. Das stimmt, aber er wurde eben nur beschleunigt, indem man administrative Prozesse abgekürzt hat. Die vielen Sicherheitstests sind davon jedoch nicht betroffen. Das Zulassungsverfahren für Impfstoffe in der EU ist zwar sehr kompliziert, aber eben auch: sehr sicher.
Oft hört man jetzt das Argument, dass zum ersten Mal ganz neuartige gentechnische Impfstoffe zugelassen werden. Doch schon seit 25 Jahren beschäftigen sich Forscher damit. Die neuen Impfstoffe verwenden die sogenannte Messenger-RNA (mRNA). Diese enthält Baupläne für Proteine, die der Zelle sagen, welche Antikörper sie herstellen muss, um sich gegen die SARS-CoV-2-Viren zu wappnen. Manche Menschen fürchten, dass der mRNA-Impfstoff auch die DNA, das Genom des Menschen, verändern kann – aber das ist chemisch unmöglich. Dieses Video zeigt es noch mal etwas anschaulicher. Ich denke, es ist beim Jahrhundertereignis Pandemie wichtig, dass möglichst viele Menschen sich eingehend informieren und früh über ihre Ängste und Unsicherheiten mit anderen sprechen. Kommunikation ist die beste Impfung gegen Impfskepsis.“
Dr. Philipp Schmid forscht an der Uni Erfurt zu Impfgegnern, Wissenschaftsleugnern und der Bekämpfung von Falschinformationen. Wie Letzteres geht, hat er zusammen mit Kollegen in einem Online-Handbuch alltagstauglich aufgeschrieben.
„Lieber krieg ich Corona, als dass ich weitere Monate alleine bin“

Psychoanalytiker Prof. Dr. Ulrich Schultz-Venrath:
„Das ist eine Aussage voller Resignation und auch versteckter Aggression. Argumentieren oder Schuldzuweisungen sind in dem Fall eher kontraproduktiv. Erkenne zunächst die Not des Gegenübers an und drücke dein Mitgefühl aus. ‚Das macht mich traurig zu hören. Ich kann dich verstehen‘, so könnte die erste Reaktion lauten, gefolgt von einer Gegenfrage, die das Gegenüber zum Perspektivwechsel anregt. Das ist ein klassisches Werkzeug des Therapeuten. Ich würde also fragen: ,Was würdest du mir antworten, wenn ich so etwas sagen würde?‘ Aber unterm Weihnachtsbaum wird natürlich in den meisten Fällen keine professionelle Therapiesitzung beginnen. Man sollte sich und dem Gegenüber vor Augen führen: Die physische Nähe mit anderen ist schön – sie ist aber nicht notwendigerweise eine Voraussetzung für die Qualität unserer Beziehungen. Lässt sich das Gegenüber ermuntern, den Kontakt mit anderen wieder aufzunehmen und auch mal neue Kommunikationswege zu gehen, die mental zusammenbringen, ist das ein Stupser in die richtige Richtung.“
Prof. Dr. Ulrich Schultz-Venrath kennt die pandemiebedingten Nöte vieler Menschen aus seiner täglichen psychoanalytischen Praxis in Köln.
„Wir leben in einer Corona-Diktatur“
Jurist Dr. Ulf Buermeyer:
„Eine Diktatur ist eine Regierungsform, in der Entscheidungen nicht vom Volk abhängen. Das ist in Deutschland nicht der Fall: Die Corona-Verordnungen stammen von den 16 Landesregierungen, und jede einzelne wurde gewählt. In manchen Bundesländern entscheiden sogar unmittelbar die Landtage über die Verordnungen.
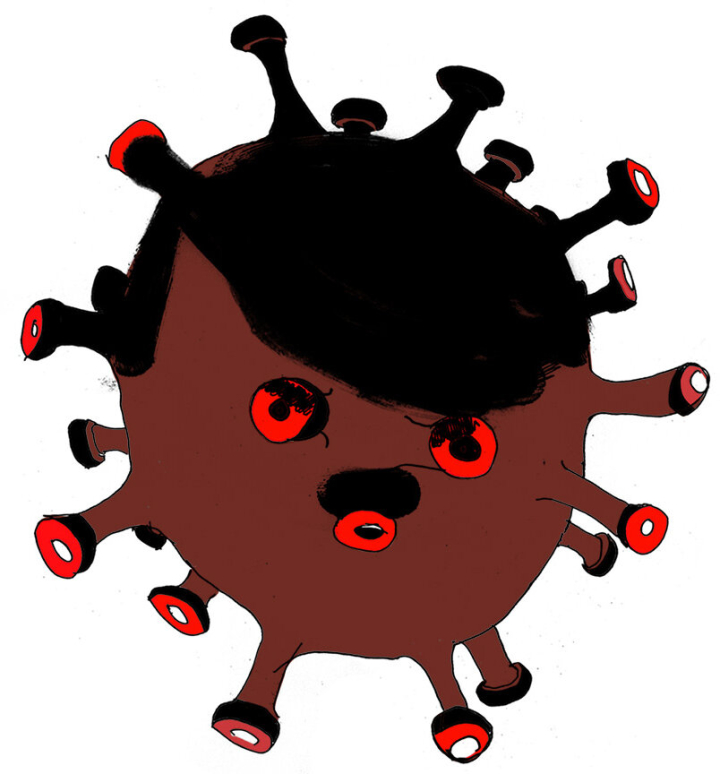
Der neue Paragraf 28 a des Infektionsschutzgesetzes liefert einen Baukasten mit Maßnahmen – etwa eine Maskenpflicht –, die Bundestag und Bundesrat vorgeben, um die Pandemie zu bekämpfen. Wenn wir sie hinter uns haben, darf der Maßnahmenkatalog nicht mehr verwendet werden.
Ganz wichtig: Der Baukasten selbst schränkt unsere Grundrechte nicht ein. Das tun erst die Länder, wenn sie sich daraus bedienen. Ist es verhältnismäßig, in der U-Bahn in Berlin eine Maskenpflicht einzuführen? Wenn ja, darf die Regel für vier Wochen gelten. Danach muss neu überprüft werden, ob sie angemessen ist – zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht. Bei dem kann jede*r Bürger*in Beschwerde gegen bestimmte Maßnahmen einlegen. Wie sich eine Maßnahme konkret auf den Pandemieverlauf auswirkt, weiß niemand so genau. Aber man kann eine Prognose abgeben, beobachten und nachsteuern. Um solche Abwägungsentscheidungen zu treffen, wählen wir Politiker*innen.
In Deutschland haben wir eine Art kapitalistische Grundentscheidung getroffen: Die Wirtschaft soll weiterlaufen. Theater, Kinos etc. werden geschlossen – dafür bleiben die Schulen zunächst lange offen, sodass Eltern arbeiten gehen und Steuern zahlen können. Damit können dann wiederum Kultureinrichtungen, Musiker*innen und Künstler*innen subventioniert werden.“
Dr. Ulf Buermeyer war einige Jahre als Richter in Berlin tätig, hostet den Podcast „Lage der Nation“ und ist Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF). Irgendwann hat er auch mal ägyptische Hieroglyphen studiert.
„Das Coronavirus ist nicht gefährlicher als die Grippe!“

Virologin Prof. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff:
„Wer die Grippe hinter sich hat, steht in den meisten Fällen aus dem Bett auf, ist vielleicht noch ein paar Tage schlapp, hat es dann aber hinter sich. Bei Covid-19 ist das nicht so. Die Influenzaviren, die die Grippe verursachen, greifen vor allem die Atemwege an; das Coronavirus kann jedoch alle Organe schädigen und die Blutgerinnung verändern, sodass gefährliche Thrombosen entstehen. Wir wissen noch wenig über das Virus, sicher ist aber: Es führt zu vielfachen und stärkeren Spätfolgen wie Müdigkeit oder Atemnot, die noch mehr als 60 Tage nach den ersten Symptomen zu spüren sind.
In der Grippesaison vor drei Jahren starben in Deutschland schätzungsweise 25.000 Menschen, ein trauriger Rekord. Laborbestätigt sind davon jedoch laut RKI nur etwa 1.600. Der Vergleich mit den Corona-Todesfällen hinkt daher. Deutschland hat bereits mehr als 24.000 Corona-Tote, alle waren positiv auf das Virus getestet, zu beklagen – und wir stehen erst am Anfang des Winters. Weltweit werden jährlich bis zu 645.000 Grippetote geschätzt, bei Corona gibt es jetzt schon über 1,6 Millionen bestätigte Todesfälle seit Anfang dieses Jahres. Würden wir dem SARS-CoV-2-Virus so begegnen wie den Influenzaviren in einer Grippesaison – ohne Mundschutz, Lüften oder Kontaktbeschränkungen: Ich mag mir nicht vorstellen, in welcher Lage wir uns jetzt befänden.“
Helga Rübsamen-Schaeff ist Professorin für Virologie und Biochemie an der Uni Frankfurt/Main und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
„Du liest doch nur Mainstreampresse. Auf Telegram gibt’s die Wahrheit!“
Journalist Stephan Anpalagan:
„Wer so in Rage ist, dass er den Kampfbegriff Mainstreampresse benutzt, braucht vielleicht mal frische Luft. ‚Komm, Onkel Willi‘, würde ich sagen, ‚wir spazieren zum Kiosk und du zeigst mir die Mainstreammedien.‘ Da wird’s zwischen ‚Taz‘ und ‚Spiegel‘, ‚Focus‘ und ‚Bild‘ spannend: Ist der ‚Spiegel‘ Mainstream? Dann lohnt es, einen aufzuschlagen. Eine Grundskepsis gegenüber Medien finde ich gut und wichtig. Aber dann sollte Onkel Willi auch konkret rausrücken, was da falsch oder gar nicht geschrieben wird. Klar macht der ‚Spiegel‘ Fehler. Aber ich habe meine Zweifel, dass Willi einen nennenswerten Teil des ‚Spiegel‘ widerlegen kann. Weiter im Kiosk: Die ‚Bild‘ wird als meistgelesene Zeitung des Landes ja wohl ein Mainstreamtitel sein? Warum berichtet sie dann völlig anders als der ‚Spiegel‘? Wir sehen: In der Detailansicht wackelt der Begriff ‚Mainstreampresse‘. Deutsche Medien sind frei und vielfältig bis zur Schmerzgrenze, für die Erkenntnis reicht schon der Besuch in diesem einen Kiosk.

Vielen Willis dürfte das aber ohnehin gleich sein. Ihnen geht es seltener um Meinungsvielfalt oder journalistische Qualität als um ihr Sendungsbewusstsein und die Opferrolle inmitten all der ‚Schlafschafe‘, die an Drostens Lippen hängen. Man glaubt einem veganen Kochbuchautor ja nicht von heute auf morgen eher als einem Virologen der Charité. Das ist ein Prozess, der tief in einen informationellen Kaninchenbau führt und an dessen Ende man als einer der wenigen vermeintlichen Selber- und Querdenker wieder auftaucht.
Darauf kann man sich einlassen: ‚Willi, ich weiß vieles nicht, und vor allem bin ich kein Virologe. Ich denke aber nach und höre zu. Lass uns reden.‘ Wenn man dann mit wissenschaftlichen Erkenntnissen argumentiert, die so gut wie jeder Wissenschaftler weltweit als wahr anerkennt, Willi aber auf Attila Hildmanns Telegram-Channel als ernst zu nehmender Informationsquelle beharrt, kann man auch einfach mal sagen: ‚Entschuldige, aber da kommen wir nicht zusammen.‘“
Stephan Anpalagan schreibt Kolumnen, Texte und Posts, die die Reichweite vieler etablierter Medien toppen. Er hat Theologie studiert, kennt sich mit „gottgleichen“ Figuren wie Christian Drosten also aus.
Illustrationen: Frank Höhne; Protokolliert von Sara Geisler, Paul Hofmann, Niklas Prenzel, Tabea Venrath
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.