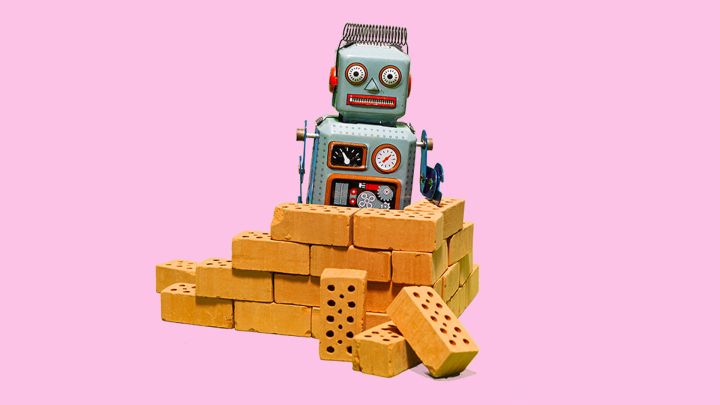Harter Job
Melanie Wolff ist eine von mehr als einer Million Langzeitarbeitslosen in Deutschland. Es ist ein Leben unter Dauerdruck, sagt Wolff. Den mache man sich vor allem selbst
Das Schlamassel, erzählt Melanie Wolff am Telefon, fing vor acht Jahren an. Sie war Anfang 30, als sie entschied, sich Vollzeit um den Haushalt zu kümmern. Wolff gab ihren Job in einer Bäckerei auf, ihr Mann ging weiter arbeiten. Statt glücklicher Ehe und trautem Heim folgte die Scheidung – nach der Wolff nicht ins Berufsleben zurückfand. Sie beantragte Arbeitslosengeld II, das viele als Hartz IV kennen.

Melanie Wolff probierte über die Jahre verschiedene Berufe aus – teils wollte, teils durfte sie nicht bleiben
Heute wohnt Wolff, mittlerweile 41, mit ihrer Mutter und ihrem Bruder zusammen. Die Familie bildet eine sogenannte „Haushaltsgemeinschaft“. Bei der wird davon ausgegangen, dass die Familienmitglieder „aus einem Topf wirtschaften“, also im Zweifel finanziell füreinander aufkommen. Als in einer Haushaltsgemeinschaft Lebende bekam Wolff viele Jahre 45 Euro weniger als den Hartz-IV-Regelsatz: 401 Euro im Monat.
Mehr als ein Alltag am Existenzminimum sei davon nicht drin, sagt Wolff. Schlimmer sei aber das sinkende Selbstwertgefühl: „Niemand brauchte mich, niemand hatte Interesse an mir“, sagt Wolff. „Ich habe mich nicht zugehörig gefühlt.“
Finanzielle Probleme würden oft von psychischen und sozialen begleitet, sagt Karsten Paul. Er forscht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu den Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit. Als langzeitarbeitslos gilt, wer ein Jahr oder länger ohne Anstellung ist. Mit der Corona-Pandemie betraf das immer mehr Menschen, trotz Kurzarbeitsprogrammen. 2019 waren laut dem Statistikdienst statista 727.500 Menschen langzeitarbeitslos, 2021 noch mal gut 300.000 Menschen mehr. „Viele Langzeitarbeitslose entwickeln Depressionssymptome und Angstgefühle“, erklärt Paul. „Die Frage, wie es mit dem eigenen Leben weitergehen soll, nimmt dann immer mehr Raum ein.“
„Man denkt, das sei ein kleines Tief und man kommt von allein wieder aus der Langzeitarbeitslosigkeit raus. Aber so leicht ist das nicht”
Paul beobachtet, dass die psychische Gesundheit im Laufe der Langzeitarbeitslosigkeit in der Regel schlechter werde, bis sie sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Natürlich gelte das nicht für alle Langzeitarbeitslosen. Einigen gehe es sehr gut ohne Job – auch auf lange Zeit. „Bei vielen entwickelt sich aber erst mit einer geregelten Erwerbstätigkeit ein Gefühl von Sinnhaftigkeit im Leben“, so Paul. Wenn sich alle um einen herum über ihren Beruf definieren und ihrem Arbeitsalltag nachgehen, raube einem die Arbeitslosigkeit mit der Zeit jedes Selbstvertrauen, sagt Melanie Wolff.
Sie ist gelernte Floristin und besuchte eine kaufmännische Wirtschaftsschule. Bevor sie beschloss, sich Vollzeit um den Haushalt zu kümmern, leitete sie acht Jahre lang die Filiale einer Bäckerei in der Nähe von Stuttgart. Nach der Scheidung probierte sie verschiedene Berufe aus. Auch in Zeitarbeit. Nichts passte so richtig: In ihren Zeitarbeitsstellen sei nicht nur die Bezahlung mies gewesen, erzählt Wolff, sondern auch die Wertschätzung. Festangestellte hätten immer mehr gegolten als Zeitarbeitskräfte.
Sie versuchte, in den Unternehmen von Zeitarbeit auf eine Festanstellung zu wechseln. Mit jedem gescheiterten Versuch stieg der Druck. „Man denkt, das sei ein kleines Tief und man kommt da von alleine wieder raus“, sagt Wolff. „Aber so leicht ist das nicht.“ Wie Wolff geht es vielen Langzeitarbeitslosen: Laut Bundesarbeitsagentur gelingt nur wenigen die Rückkehr in einen regulären Job.
Bei Melanie Wolff wurden die Existenzängste mit der Zeit immer größer. Irgendwann kamen depressive Schübe. Dauerhaft einen Beruf aufzunehmen wurde so immer schwerer. „Ich hatte Angst vor Vorstellungsgesprächen, vor unangenehmen Fragen. Sobald man das Wort ‚Depression‘ oder ‚Langzeitarbeitslosigkeit‘ in den Mund nimmt, ist man raus.“ Als vor vier Jahren Wolffs Vater verstarb, ging es ihr so schlecht, dass sie sich in einer Tagesklinik in Therapie begab.
Über die Jahre der Jobsuche wurde Wolff einsamer. Sie verlor Freunde und Freundinnen. „Mir fehlte das Geld, um an ihrem Lebensstil teilzunehmen.“ Wolff hat auch den Verdacht, dass sich manche ihrer Freunde und Freundinnen für eine Arbeitslose im Freundeskreis schämen. „Vor der Hochzeit von Freunden wurde mir verboten zu sagen, dass ich Hartz IV empfange.“ Sie solle sich einen Beruf ausdenken oder dem Thema aus dem Weg gehen.
Die Pandemie sei ihr deshalb erst mal ganz gelegen gekommen, erzählt Wolff: Sie musste nicht länger Ausreden suchen, warum sie nicht verreist oder ins Restaurant geht. Allerdings sei es im Lockdown schwerer als ohnehin schon, einem Leben ohne feste Arbeitszeit eine Struktur zu geben. Und neuerdings seien auch die Ämter schwerer zu erreichen, sagt Wolff. Das macht es vielen schwerer, Fragen zu ihren Hartz-IV-Sätzen zu stellen.
Wer langzeitarbeitslos ist, braucht nicht nur Unterstützung auf dem Arbeitsmarkt
Diese Sätze wurden gerade erhöht. Seit Januar 2021 erhalten Erwachsene einen Hartz-IV-Regelsatz von 449 Euro, Jugendliche 376 Euro – drei Euro mehr. Als in einer Bedarfsgemeinschaft Lebende bekäme Wolff nun 404 Euro im Monat. „Witzlos“, nennt Wolff die Erhöhung. „Die drei Euro können sie behalten.“
Wofür wird Hartz-IV gezahlt? Der „Regelbedarf“ beim Arbeitslosengeld II soll den Lebensunterhalt sichern. Also vor allem die monatlichen Kosten für Ernährung, Kleidung, Hygieneprodukte und Hausrat decken. Auch die Aufwände für Wohnung und Heizung werden in der Regel übernommen, wenn sie vom Amt als „angemessen“ eingestuft werden. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 25 können zusätzlich Zuschüsse für Schulausflüge, Nachhilfe oder Sportvereine beantragt werden.
Vier Jahre verdiente sich Wolff durch eine Arbeitsgelegenheit monatlich 100 bis 200 Euro dazu. Der Job bei der Tafel gab ihrem Alltag Struktur, sie traf Leute. Und die Tafel stellte ein Busticket, das sie auch privat nutzen durfte. „Allein das Ticket hat sehr viel Druck rausgenommen“, sagt Wolff. Mit dem Zuverdienst und dem Ticket sei sie zwar über den Monat gekommen. Aber die Lebenskosten steigen, sagt Wolff, und wer kein Geld zurücklegen könne, gehe ein dauerhaftes Risiko ein: Geht morgen ihre Waschmaschine kaputt, hat sie ein Problem. Dazu ist Wolff Diabetikerin und übergewichtig. Sie will sich gesünder ernähren. Am Ende mancher Monate reiche es aber nur noch für Fertiggerichte, erzählt sie. „Oder ich gehe zur Tafel essen. Da kann ich mir aber nicht aussuchen, was ich bekomme.“
Statt der drei Euro hält Wolff eine Erhöhung um 100 Euro für sinnvoll: „Von 550 Euro kann man anständig leben.“ Wichtig sei für Langzeitarbeitslose aber auch Unterstützung, die über die Arbeitsvermittlung hinausgeht. Wolff hat erst in der Therapie gelernt, wie sie ihrem Tag Abläufe gibt. Mit einer festen Tagesstruktur lebt sie gesünder. Mittlerweile gehe sie jeden Tag 15 Kilometer spazieren, erzählt Wolf am Telefon. „Ich habe einen Partner, ich habe Freunde. Ich mache etwas aus mir.“
Anfang Dezember vermittelt ihr der Bundesfreiwilligendienst eine Stelle: Melanie Wolff betreut Kinder in einem Waldkindergarten. Mit Zuschüssen kommt sie auf etwa 600 Euro. Aber Wolff ist zufrieden. Sie hofft, endlich einen Beruf gefunden zu haben, in dem sie bleiben kann. Nach dem Freiwilligendienst will sie in Stuttgart eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin anfangen.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.