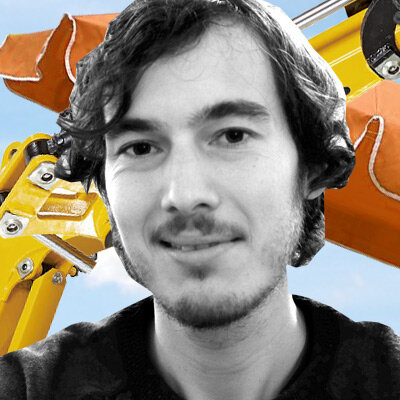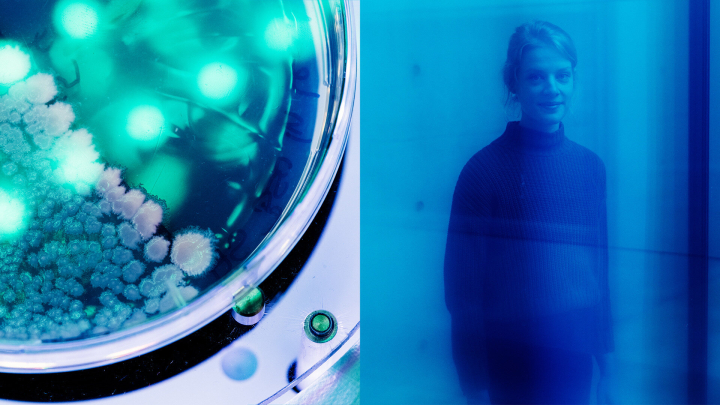Sollte man demokratiefeindliche Parteien verbieten?
Ob ein Parteiverbot ein wirksames Mittel ist, um verfassungsfeindliche Ideologien loszuwerden, darüber lässt sich streiten

Nein, denn Verbote helfen nicht gegen Einstellungen
sagt Valentin Ihßen
Rassismus, Antisemitismus und andere rechtsextreme Einstellungen haben sich einer Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung zufolge in den letzten Jahren verdreifacht – und das in der Breite unserer Gesellschaft. Gleichzeitig sinkt das Vertrauen in unsere Institutionen, und demokratiefeindliche Parteien bekommen immer mehr Aufwind. Das alles ist alarmierend und bedroht unsere Demokratie massiv. Dennoch ist ein Parteiverbot dafür keine Lösung, es wäre sogar schädlich.
Die Hoffnung derer, die ein Verbotsverfahren fordern, ist, dass damit sogar schon vor seiner Durchsetzung Wähler:innen abgeschreckt werden könnten. Doch diese Hoffnung ist trügerisch. Denn Rechtspopulisten setzen schon lange auf ein bewährtes Erfolgsrezept: Hier das wütende Volk, dort die Verschwörung mächtiger Eliten. Mit diesem Trick inszenieren sie sich als einzig wahre Vertreter:innen eines angeblichen Wählerwillens. Und alles, was nicht in dieses Muster passt, wird als Gegenkampagne abgetan. Es wäre also ein Leichtes für sie, ein Parteiverbotsverfahren zu instrumentalisieren, um sich als wahre Demokrat:innen im Kampf mit einem autoritären Rechtsstaat darzustellen – so wie Trump aktuell in den USA. Weil ein Parteiverbotsverfahren mehrere Jahre dauern kann, hätten sie dafür jede Menge Zeit und könnten diese Strategie im Wahlkampf einsetzen. Allein das Verbotsverfahren könnte ihnen also mehr Unterstützer bringen.
Verfassungsfeindliche Forderungen reichen nicht, um eine Partei zu verbieten
Außerdem ist der Ausgang eines Verbotsverfahrens ungewiss – und damit hochriskant: Verfassungsfeindliche Forderungen reichen bei weitem nicht aus, um eine Partei zu verbieten. Es braucht auch eine „aktiv kämpferische, aggressive Haltung“, planvolles Handeln, das sich auf die Beseitigung der demokratischen Grundordnung richtet, und Anhaltspunkte, die das Vorhaben möglich scheinen lassen. Ob diese Kriterien im Einzelfall nachgewiesen werden können, ist unklar – bei der NPD konnten keine realen Durchsetzungsmöglichkeiten festgestellt werden. Das Verbotsverfahren 2017 scheiterte (wie auch schon 2003). Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht tatsächlich für ein Verbot entscheiden würde, was bisher erst zwei Mal vorgekommen ist, könnte es immer noch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg angefochten werden. Was dagegen sicher ist: Scheitert das Verbot, dann würden sich Demokratiefeinde in ihren Ansichten bestärkt sehen. Schlimmer noch: Sie könnten das Urteil sogar für sich nutzen und sich das Label „verfassungskonform“ auf die Fahne schreiben.
Und angenommen, ein Verbotsverfahren hätte Erfolg – was wäre dann für die Demokratie gewonnen? Man müsste befürchten, dass sich Anhänger und Funktionäre demokratiefeindlicher Parteien weiter radikalisieren oder sogar in den Untergrund gehen – rechtsextreme Einstellungen lösen sich ja nicht durch ein Parteiverbot in Luft auf. Wie gefährlich rechtsextremer Terror ist, haben die Morde in Hanau oder der Fall Walter Lübcke gezeigt.
Das Strafrecht bietet schon jetzt genügend Möglichkeiten, gegen Hetze vorzugehen
Und außerdem: Es gibt andere wirksame Mittel, mit denen wir gegen die Verfassungsfeinde vorgehen können. Gegen wachsende demokratiefeindliche Einstellungen brauchen wir eine stärkere demokratische Kultur von unten: gute politische Bildung, demokratische Beteiligung an Schulen und am Arbeitsplatz, staatliches Geld für zivilgesellschaftliche Demokratieprojekte und ein besserer Schutz für Demokrat:innen, die sich in den Kommunen und Stadtparlamenten engagieren. Hassrede in den sozialen Medien oder gewalttätige Übergriffe auf marginalisierte Gruppen können und müssen verfolgt werden – das Strafrecht bietet dafür schon jetzt die Möglichkeit und muss konsequent angewendet werden. Zu guter Letzt noch: Solange Politiker:innen aus demokratischen Parteien nicht mit rechtsextremen Parteien zusammenarbeiten oder ihre Positionen übernehmen, kann die Macht der Demokratiefeinde beschränkt werden – selbst wenn sie bei Wahlen stärkste Kraft werden.
Ja, ein Parteiverbot ist ein legitimes Instrument, das genutzt werden muss
meint Ralf Pauli
Ein Parteiverbot ist immer dann eine heikle Forderung, wenn die Partei, die verboten werden soll, gerade von Wahlerfolg zu Wahlerfolg stürmt. Wenn derzeit also Politiker von CDU, SPD oder Grünen verlangen, ein Verbotsverfahren gegen die AfD zu prüfen, riecht das nach frustrierten Konkurrenten. Es wirkt hilflos, opportun, mitunter panisch. Das heißt aber nicht, dass die Forderung deshalb automatisch falsch ist.
Das Grundgesetz erlaubt den Ausschluss von Parteien aus gutem Grund. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren sich die demokratischen Kräfte sicher gewesen, die Nationalsozialisten mit einer Regierungsbeteiligung einhegen, bändigen, mäßigen zu können. Ein fataler Irrtum. Die Demokratiefeinde haben die Demokratie gekapert – um sie von innen heraus zu untergraben. Deshalb hielten die Gründungsmütter und -väter der BRD als Konsequenz aus dem Aufstieg der NSDAP und dem Zweiten Weltkrieg das Parteiverbot in der Verfassung fest. Unsere Demokratie muss sich gegen ihre Feinde zur Wehr setzen können.
Verbote sind dafür da, rote Linien zu ziehen
Zwei Argumente werden häufig gegen das Parteiverbot angeführt. Erstens: Wer eine radikale Partei verbietet, bekämpfe nur die Symptome. Die radikalen Ideen und Einstellungen in der Bevölkerung würden dadurch nicht verschwinden, eine Dämonisierung könnte sogar das Gegenteil bewirken. So gegen ein Verbot zu argumentieren ist allerdings, als würde man sich gegen die Aufstellung eines Tempo-30-Schildes in einer gefährlichen Straße wehren, weil man befürchtet, viele Autofahrer könnten die Notwendigkeit der Maßnahme bezweifeln und aus Wut über die Beschränkung gerade extra schnell fahren. Ob es jetzt um den Schutz von Fußgängern oder die Grundrechte von Minderheiten, Journalisten oder politischen Gegnern geht: Verbote sind nicht vorrangig dafür da, um uneinsichtige Menschen zur Einsicht zu bringen – sondern um rote Linien zu ziehen. Die Zufriedenheit mit den demokratischen Institutionen kann der Staat weder einfordern noch erzwingen. Werden sie aber angegriffen, muss er sie verteidigen. Notfalls, indem er eine Partei stoppt, die die Unzufriedenen mit antidemokratischen Verheißungen blendet und lockt.
Ohne finanzielle Mittel fällt es Parteien viel schwerer, sich zu vernetzen
Das zweite Gegenargument ist da schon stichhaltiger: Was, wenn das Verbotsverfahren scheitert, hätte die geprüfte Partei dann nicht die höchste amtliche Bestätigung, nie verfassungsfeindlich gewesen zu sein? Diese Gefahr besteht natürlich. Allerdings ist auch dies kein Grund gegen ein Verbotsverfahren: Selbst ein „Freispruch“ kann dazu führen, dass der Partei die staatliche Finanzierung gestrichen wird, wie beim jüngsten Verfahren gegen die rechtsradikale Partei NPD. Denn generell finanziert der deutsche Staat die relevanten, also im Bundestag vertretenen Parteien großzügig. Warum sollte er das tun bei Parteien, die sich erwiesenermaßen an unseren Grundwerten Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaat vergreifen möchten und somit seinen eigenen Untergang fördern?
Ohne finanzielle Mittel würde es der Partei viel schwerer fallen, sich zu vernetzen, Veranstaltungen zu organisieren, Wahlkampf zu machen. Außerdem kann ein Parteiverbotsverfahren mitunter Jahre dauern, und es bleibt offen, was für Informationen über die Partei ans Licht kommen und welche Wirkung das langfristig auf die Wählerinnen und Wähler hat. Obwohl die NPD letztlich nicht verboten wurde, zeigt sich in Umfragen, dass die Zustimmung während des zweiten Verbotsverfahrens gesunken ist.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.
Collage: Renke Brandt