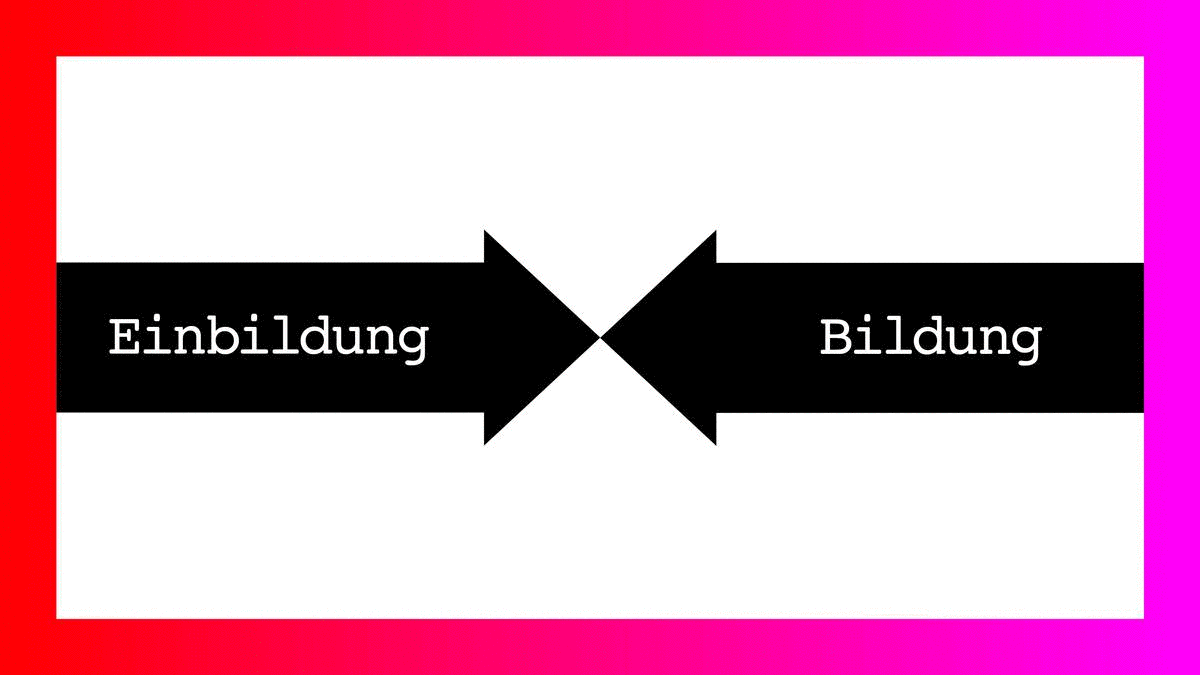Und jetzt alle zusammen?
Flüchtlingskrise, Rechtsruck, Brexit: Hat die EU nur eine Zukunft, wenn aus lauter Einzelstaaten die Vereinigten Staaten von Europa werden? Ein Streitgespräch

Die EU nicht länger als loses Staatenbündel, sondern als föderale Union, in der Deutschland nur mehr ein Bundesstaat unter vielen ist? Das wird seit Jahrzehnten diskutiert. (Winston Churchill träumte davon sogar schon 1946.) Anfang der 2000er hat ein Konvent, also eine Versammlung mit Vertretern aller Mitgliedstaaten, sogar schon mal die bestehenden Verträge zwischen den EU-Staaten in eine gesamteuropäische Verfassung umgearbeitet. Die scheiterte an Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden – so weitreichende Entscheidungen können in der EU nur einstimmig getroffen werden.
Die Diskussionen über ein föderales Europa hat das nicht beendet: Sollten die Nationalstaaten viel allein entscheiden – oder verlangen gemeinsame Herausforderungen wie Klimawandel oder Migration gar so etwas wie die „Vereinigten Staaten von Europa“? Wir haben die Politikwissenschaftler*innen Sandra Seubert und Francis Cheneval gefragt – die diese Fragen unterschiedlich sehen.
Die EU ist ein wirtschaftlicher und politischer Zusammenschluss von aktuell 27 Staaten. Es gibt einen gemeinsamen Binnenmarkt, ein Europäisches Parlament, die Europäische Kommission, einen Europäischen Rat und einen Rat der Europäischen Union, in dem die Mitgliedstaaten über ihre Staatschef*innen vertreten sind. (Hier sind die EU-Spitzenpositionen einmal einfach erklärt.) Maßnahmen werden von der EU überwiegend gemeinschaftlich beschlossen, die Mitgliedstaaten können aber jederzeit auch aus der Union austreten. Anfang 2020 hat das Vereinigte Königreich genau das getan. Zugleich ist es gar nicht so einfach, Teil der Europäischen Union zu werden: Vom EU-Beitrittsantrag bis zum tatsächlichen Beitritt vergehen oft mehrere Jahre, manche Beitrittsanfragen werden auch abgelehnt.
fluter.de: Frau Seubert, Herr Cheneval, bevor wir über die Zukunft sprechen: Wie würden Sie denn das aktuelle System der EU beschreiben?
Francis Cheneval: Die EU ist ein föderales System, in dem die Nationalstaaten über Verträge viele Kompetenzen an die EU abgegeben haben, stark eingebunden und besonders ökonomisch ineinander verkrallt sind. Die EU ist quasi eine höhere Zivilisationsstufe der internationalen Beziehungen, mit sehr viel engerer Zusammenarbeit und Rechtssicherheit.
Sandra Seubert: Gleichzeitig hat die EU in einigen wesentlichen Bereichen keine föderale Struktur. Es gibt viele Möglichkeiten, sich aus der gemeinsamen Sache herauszuhalten – es haben ja beispielsweise auch nur 19 Staaten den Euro. Und es gibt grundsätzlich das Recht zum EU-Austritt. Das steht in einer gewissen Spannung.
Cheneval: Da stellt sich mir die Frage: Muss denn die EU „zu Ende“ geführt werden – hin zu einem europäischen Bundesstaat, aus dem keiner mehr austreten kann? Auch so eine Zwangsunion kann auseinanderbrechen. Der EU das Austrittsrecht zu nehmen wäre, wie bei einer Ehe das Scheidungsrecht abzuschaffen.
Seubert: Die Option zum Austritt ist meiner Meinung nach aber immer eine Scheinsouveränität. Mit dem eropäischen Binnenmarkt und der gemeinsamen Währung wurden die Nationalstaaten immer abhängiger voneinander – ohne dass diese Abhängigkeit jemals wirklich demokratisch begründet wurde. Wir haben also durch ökonomische Integration einen europäischen Kapitalismus entstehen lassen, ohne dass eine europäische Demokratie mitgewachsen wäre. Diese Demokratisierung müssen wir jetzt nachholen.
„Das EU-Parlament sollte eigene Steuern erheben, um mit dem eingenommenen Geld europäische Politik machen zu können“Sandra Seubert
Herr Cheneval, sehen Sie dieses Demokratiedefizit auch?
Cheneval: Die EU einen Kapitalismus ohne Demokratie zu nennen ist wirklich ein starkes Stück. Es gibt kein institutionelles Demokratiedefizit, höchstens eine ungenügende Identifikation mit der EU.
Seubert: Dieser Diskurs über die Identifikation endet meist in: „Wir haben die nicht, deshalb können wir nicht …“ Dabei geraten doch die gemeinsamen Interessen aus dem Blick: Die EU baut kontinuierlich nationale Schranken ab, um den Markt anzukurbeln. So geschehen etwa beim Euro oder bei der sogenannten Freizügigkeit, die EU-Bürger*innen erlaubt, innerhalb der EU leben und arbeiten zu können, wo sie wollen. Wenn der europäische Markt dann mal reguliert werden soll, ist es aber sehr viel schwieriger, in Brüssel die Mehrheiten zu bilden, die Veränderungen brauchen. Und für die Sozialpolitik ist ohnehin nach wie vor jeder Staat weitgehend selbst zuständig.
Cheneval: Die Staaten sind wirtschaftlich stark in die EU eingebunden. Und wegen dieser ökonomischen Verpflichtungen muss jetzt unbedingt Demokratie nachwachsen?
Seubert: Ja! Denn der Euro und die Freizügigkeit sind doch total beliebt. Das Problem ist, dass die nationalen Regierungschef*innen und Minister*innen jeder Veränderung zustimmen müssen. Die werden aber nicht mit einer europäischen Agenda gewählt, sondern sind von ihrer nationalen Wiederwahl abhängig.
Es gibt also zu viele nationale Interessen im europäischen Projekt. Wie löst man das Problem?
Seubert: Europaweite Listen und Parteien und die Stärkung des Europaparlaments sind ganz wichtig. Dann kann auch die europäische Identität wachsen, die uns gerade fehlt.
Cheneval: Europaweite Listen sind eine sehr elitäre Idee. Die Abgeordneten sind national doch viel enger verbunden mit ihren Wählern als mit potenziellen Wählern in ganz Europa. Außerdem sind europaweite Wahlkämpfe enorm teuer.
Seubert: Ich denke, dass das Europäische Parlament eigene Steuern erheben können sollte, um mit dem eingenommenen Geld Politik im europäischen Sinne machen zu können. Zum Beispiel mit einer europäischen Arbeitslosenversicherung oder in Sachen Klimaschutz. Solche europäischen Gemeinschaftsanliegen gibt es immer noch viel zu wenig. Deshalb profitieren manche Länder auch immer noch stärker von der EU als andere.
Zum Beispiel?
Seubert: Durch die Bewegungsfreiheit wandern Arbeitskräfte logischerweise dahin, wo sie mehr verdienen. Davon profitieren Länder wie Deutschland enorm. Was diese Abwanderung in den Herkunftsländern anrichtet, interessiert uns aber nicht. Umverteilen, das machen wir weitgehend national.
Warum gibt es denn keine gemeinsame Sozialpolitik?
Seubert: Aktuell reicht das Veto eines einzigen Mitgliedstaats, um das zu verhindern. Ein Konvent, in dem Vertreter aller Mitgliedstaaten diskutieren, könnte aber solche Strukturen schaffen. Und eine Verfassung erarbeiten für das Europa, das wir wollen.
Cheneval: Ein Konvent sollte eher die Sachzwänge abbauen, die der EU-Binnenmarkt geschaffen hat. Damit hätten die Mitgliedstaaten auch mehr Freiheiten, ihre Sozialpolitik zu gestalten.

Sandra Seubert ist Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie erforscht unter anderem, wie Demokratie über nationale Grenzen hinweg wirkt

Francis Cheneval ist Professor an der Uni Zürich. Er beschäftigt sich mit Demokratietheorien und den Problemen, die durch die Kooperation verschiedener Länder in der EU auftreten
Am Wochenende hat die „Konferenz zur Zukunft Europas“ begonnen: Rund ein Jahr diskutieren Bürger*innen online über die politischen Prioritäten und die Struktur der EU. Was erwarten Sie von dem Projekt?
Seubert: Im schlechtesten Fall eine Schaufensterveranstaltung, bei der Bürger*innenbeteiligung nur simuliert wird. Dabei ist der Reformbedarf groß, und wir müssen über Punkte reden, an denen die EU-Bürger*innen zu Recht handlungsfähige Institutionen erwarten: Klimaschutz, Sozialstaatliches, Migration …
Zeigen das Scheitern in der gemeinsamen Flüchtlingspolitik, der Brexit oder rechtsnationale Bewegungen, dass eine föderale EU utopisch ist? Das scheint mir der Grundkonflikt zwischen Ihren Positionen: Braucht es erst eine föderale EU, um gemeinsam inhaltliche Lösungen zu finden – oder erst gemeinsame inhaltliche Positionen?
Seubert: Das Scheitern des Dublin-Verfahrens und einer europäischen Migrationspolitik zeigt, dass man von vornherein eine funktionierende Struktur braucht, die die Länder dazu bringt, gemeinsam Probleme zu lösen. Wir brauchen eine EU, die klare Kompetenzen hat und weniger nationalstaatlich funktioniert. Das wird natürlich schwierig, die Fliehkräfte sind groß. Aber es ist noch kein Problem gelöst, wenn wir denen einfach nachgeben.
Cheneval: Ich denke, es zeigt, dass ein föderales Ethos notwendig ist, sagen wir eine Art gesamteuropäisches Verantwortungsgefühl. Ist das vorhanden, stärken wir Europa mit Konsens und nicht mit Zwang.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.
Collage: Renke Brandt