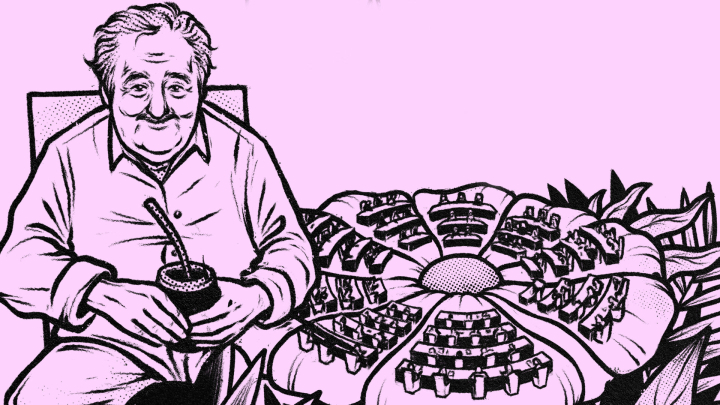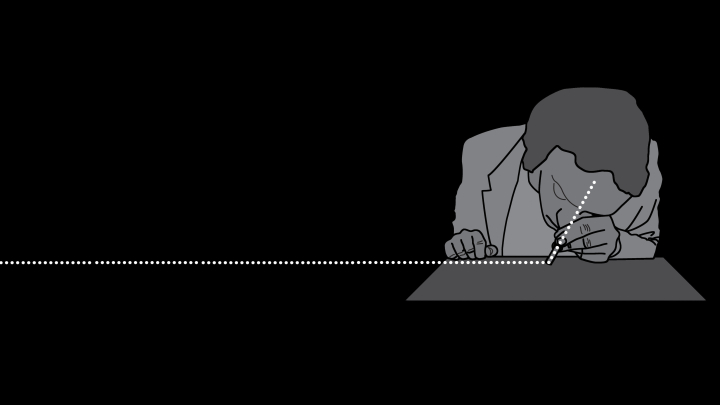„Wir könnten Pioniere sein“
Als erstes Land hat Uruguay vor knapp zehn Jahren Cannabis legalisiert. Heute sagen dort viele: Man hätte es anders machen müssen. Was kann Deutschland davon lernen?

Als Alicia Chavert begann, Gras zu verkaufen, standen die Kunden Schlange. Manche fuhren jede Woche über eine Stunde bis zu ihrer Apotheke in Las Flores, einem kleinen Ort an der Küste Uruguays. „Irgendwann haben wir unser Facebook-Profilbild von Grün auf Rot gestellt, sobald der Vorrat aufgebraucht war“, erzählt Chavert. „La Cabina“ war die einzige Apotheke im Bezirk, die Cannabis anbot. Die Nachfrage sei so groß gewesen, dass der Staat mit der Produktion nicht mehr hinterherkam.
Fast sechs Jahre nach dem Verkaufsstart steht vor „La Cabina“ niemand mehr Schlange. Chavert ist trotzdem vorbereitet: Zwischen Zahnpasta und Kopfschmerztabletten hat die Apothekerin ein Sortiment an langem Zigarettenpapier ausgelegt, in einer Vitrine stehen mit Hanfblättern verzierte Glaspfeifen und Grinder. „Früher haben wir mehr verkauft“, sagt sie und ordnet einen Stapel mit Flyern zu verantwortungsvollem Cannabiskonsum.
Zwei Drittel der Bevölkerung war gegen die Cannabis-Legalisierung
2013 legalisierte Uruguay als erstes Land weltweit die Produktion und den Verkauf von Cannabis zum Freizeitkonsum. Gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung: Rund zwei Drittel lehnten das Gesetz damals ab. „Die Rückwärtsgewandten werden Angst bekommen“, sagte der damalige Präsident José Mujica. „Aber ich fürchte mich nicht vor ihren Höhlenmenschen-Argumenten.“ Mit der Legalisierung wollte Mujica den illegalen Drogenhandel bekämpfen. Und die Konsumenten vor minderwertiger Schwarzware aus Paraguay schützen, die den Cannabismarkt in Uruguay dominierte.
Laut Gesetz darf seitdem jeder, der volljährig ist und sich offiziell registriert, sechs Cannabispflanzen anbauen; und bis zu 99 Pflanzen, wenn sich die Person einem Club mit maximal 45 Mitgliedern anschließt. Wer nicht selbst anbauen will, kann bis zu 40 Gramm im Monat in lizenzierten Apotheken kaufen. Die Regelungen sind großzügiger als die, die Deutschland vorsieht: Hierzulande soll jeder Erwachsene drei Pflanzen selbst anbauen und 25 Gramm straffrei kaufen können. Auch sogenannte „Cannabis-Clubs“ sind vorgesehen.

Aber in einem zentralen Punkt ähneln sich beide Länder: Statt den Cannabiskonsum dem freien Markt zu überlassen, wollen sie ihn staatlich regulieren. Über die konkrete Ausgestaltung der Legalisierung in Deutschland wird gerade im Bundeskabinett diskutiert, die Erkenntnisse aus zehn Jahren Legalisierung in Uruguay können dabei Impulse geben. Welche Auswirkungen hatte die Legalisierung auf den Konsum? Wie stark kann der Staat, wie stark muss er regulieren? Und wo hapert es konkret in der Umsetzung?
„Wir haben damals viele Entscheidungen getroffen, ohne dass wir Vorbilder hatten“, sagt Diego Olivera. Er war damals Präsident des Instituts für die Regulierung und Kontrolle von Cannabis (IRCCA), das mit der Verabschiedung des Gesetzes gegründet wurde. Welchen THC-Gehalt darf das lizenzierte Cannabis haben? Wie viele und welche Firmen bekommen eine Lizenz zum Anbau? Müssen die Samenbanken, die die Marihuanasamen verkaufen, ebenfalls lizenziert werden? Was muss eine Fachkraft können, die Cannabis anbaut?
Jede Entscheidung des IRCCA sei ein Kompromiss gewesen, sagt Diego Olivera, ein Abwägen zwischen dem Regierungsauftrag zu legalisieren und den zahlreichen Bedenken der Ministerien und Aufsichtsbehörden. Und Kompromisse brauchen Zeit: Die Apotheken begannen erst im Sommer 2017, Cannabis zu verkaufen.
„Vielen schmeckt das Gras aus der Apotheke nicht, oder sie kriegen dort nicht genug Abwechslung. Auch ein legales Produkt muss attraktiv sein, damit es jemand kauft“
Eine Studie, die die staatliche Drogenaufsichtsbehörde 2019 vorlegte, konnte Bedenken ausräumen. Nach der Legalisierung stieg der Konsum zwar an, aber in einem ähnlichen Maß wie vor dem Gesetz. (Wobei es hier um den erfassten Konsum geht, die Dunkelziffer erschwert den direkten Vergleich.) Der Anteil an Menschen mit problematischem, also gesundheitsgefährdendem Konsum blieb stabil, das Alter des erstmaligen Konsums stieg sogar von 18 (im Jahr 2011) auf 20 (2018). Aktuelle Zahlen will die Drogenaufsichtsbehörde im kommenden Jahr herausgeben.

Das größere Problem für Uruguay sind die Verkaufszahlen: Nur knapp jeder dritte Konsument kauft auf dem legalen Markt. Der Absatz sinkt, nicht nur in Alicia Chaverts Apotheke. Und das, obwohl das Gras dort günstig ist und von staatlichen Laboren geprüft wird. Woran liegt das?
Zum einen an der schlechten Infrastruktur. Von knapp 1.000 Apotheken in ganz Uruguay haben nur 38 eine Verkaufslizenz. In manchen Bezirken gibt es bis heute keine Anlaufstelle für Konsumenten. Das liegt vor allem an der Sorge der Apotheker, dass die Bank ihr Konto einfrieren könnte: Viele Banken, nationale und ausländische, halten sich aus dem Cannabisgeschäft raus, weil sie riskieren, damit gegen internationale Geldwäschevorschriften zu verstoßen. Diese Hürde droht auch Deutschland, das an EU-Recht und das Schengener Abkommen gebunden ist: Beide verbieten das Herstellen, Verkaufen und Ein- und Ausführen von Drogen.
Bei Alicia Chavert läuft alles cash. Das Geld lagert sie in einem Safe; aber die meisten anderen Apotheken verzichten auf das Cannabisgeschäft. „Es war ein Fehler, die Apotheken als einzige Verkaufsstellen in das Gesetz zu schreiben“, sagt Diego Olivera. Der Staat habe überreguliert, als er im Gesetz von 2013 keine alternativen Geschäfte zum Verkauf eingeplant hat. Eine Änderung des Gesetzes sei unwahrscheinlich, sagt Olivera, der rechte Präsident Luis Pou ist ein erklärter Legalisierungsgegner. So lässt sich die schlechte Versorgungslage auch Jahre nach Verkaufsbeginn kaum verbessern.
„Wir könnten Pioniere sein“, sagt Joaquín und zündet sich einen Joint an. „Stattdessen sind wir im Jahr 2013 stehen geblieben.“ Er sitzt neben seinem Bruder Manuel im Wohnzimmer ihres Cannabisclubs in einem kleinen Ort etwa zwei Autostunden von Montevideo entfernt. Durch das Fliegengitter drückt sich die dicke Luft des Gewächshauses nebenan. Die Brüder heißen anders, wollen aber anonym bleiben, um freier sprechen zu können.
Nur drei Sorten sind staatlich lizenziert, vielen ist das nicht genug Auswahl
Den Club haben sie vor fünf Jahren aufgebaut. Mittlerweile können sie von dem Geld leben, das sie durch die Mitgliedsbeiträge einnehmen, sagt Joaquín. Mit 99 Pflanzen und 21 Kilogramm, die sie jährlich für 45 Mitglieder ernten, bewege sich der Club knapp an der Grenze des Erlaubten. Wenn sie dürften, würden sie gern in großem Maßstab produzieren und verkaufen. Aber nach dem Gesetz sind Clubs als Gemeinschaftsgärten unter Freunden vorgesehen, nicht als Unternehmen.

Den 38 Apotheken stehen heute 296 Clubs gegenüber. Sie sind über das ganze Land verteilt. Die Brüder sind überzeugt: Hätten sie mehr Freiheiten, könnten sie dem Staat im Kampf gegen den Schwarzmarkt helfen. „Das Gesetz erlaubt uns mitzuspielen, aber es hält uns klein“, sagt Joaquín. Stattdessen fängt der Schwarzmarkt oft schon am Hinterausgang der Clubs an. Wenn die Kosten-Nutzen-Rechnung der Clubs aufgehen soll, können sie sich kaum Mitglieder leisten, die ihnen weniger als 40 Gramm im Monat abnehmen. Wer nicht so viel rauchen will, verteilt oder verkauft das Gras also oft weiter. Legal angebaut – illegal erworben.
In ihrem Gewächshaus führen Joaquín und Manuel durch Reihen schulterhoher Pflanzen, sie schneiden Seitentriebe ab und deuten auf Blüten. „Die hier habe ich zum ersten Mal gepflanzt, aber ich sehe schon, dass sie eine gute Struktur hat“, sagt Manuel. Er streicht mit dem Finger über eine Blüte. „Wird ein geniales Aroma haben.“
Auch ein Verkauf an Touristen wird disktutiert
Acht bis zehn Sorten bauen die Brüder auf ihrer Kleinplantage an. Staatlich lizenziert waren bis vor kurzem zwei Sorten – eine neue mit höherem THC-Gehalt, „Gamma III“, ist seit Dezember zugelassen. Auch ein legales Produkt muss attraktiv sein, damit die Leute es kaufen, findet Manuel. „Vielen Leuten schmeckt das Gras aus der Apotheke nicht, oder sie kriegen dort nicht genug Abwechslung.“ Wer da nicht selbst anbaue oder sich keine Clubmitgliedschaft leisten könne, kaufe eben schwarz.

Um wieder mehr lizenziertes Cannabis zu verkaufen, diskutiert Uruguay, ob die Apotheken auch an Touristen verkaufen dürfen sollten. Viele halten es für erfolgversprechender, den Cannabisclubs zu erlauben, an alle staatlich Registrierten (statt nur an Mitglieder) zu verkaufen – was den Behörden allerdings deutlich mehr Kontrollen abverlangen würde.
Diego Olivera hält es für ein gutes Zeichen, dass überhaupt diskutiert wird. „Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, wie weit wir liberalisieren. Gleichzeitig müssen wir aber nach Wegen suchen, um den legalen Markt so groß wie möglich zu machen“, sagt er. Deutschland würde er raten, von Anfang an ein Angebot zu schaffen, das die Bedürfnisse befriedige. Auch wenn das erst mal zu liberal wirken könnte. „Sonst entstehen unweigerlich Parallelmärkte.“
In den ersten Jahren nach der Legalisierung verlor der Schwarzmarkt rund 22 Millionen US-Dollar an Einnahmen, rechnet das IRCCA. „Das Problem des illegalen Handels an sich kriegen wir nicht gelöst“, gibt Olivera zu. Das große Geld bringe immer noch der Transit von bolivianischem Kokain, das über Uruguay nach Europa gebracht werde. „Aber Cannabis ist die meistkonsumierte Droge in Uruguay, und mit der Legalisierung haben wir erreicht, dass sich weniger Konsumenten in illegalen Kreisen aufhalten.“ Mehr Menschen hätten nun Zugang zu Cannabis in guter Qualität – selbst wenn sie sich nicht registrierten.
Durch die Tür von Alicia Chaverts kleiner Apotheke in Las Flores ist eben eine Stammkundin gekommen. „Welche Sorte willst du?“, fragt Chavert. „Die neue.“ Die Apothekerin zieht zwei Tütchen aus einem Pappkarton hinter der Theke, „Gamma III“ steht in Großbuchstaben darauf, darunter: ≤ 15 Prozent THC. Sie scannt den Barcode, und als die Kundin ihren Daumen auf den Fingerscanner legt, bekommt Chavert eine Freigabe.
„Die neue Sorte kommt gut an“, sagt sie und schiebt den Karton zurück ins Regal. „Viele Kunden kommen zurück, die vorher woanders gekauft haben.“ Das bestätigt auch die Drogenaufsichtsbehörde. Laut ersten Untersuchungen holt „Gamma III“ wieder mehr Konsumenten in die Apotheke.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.