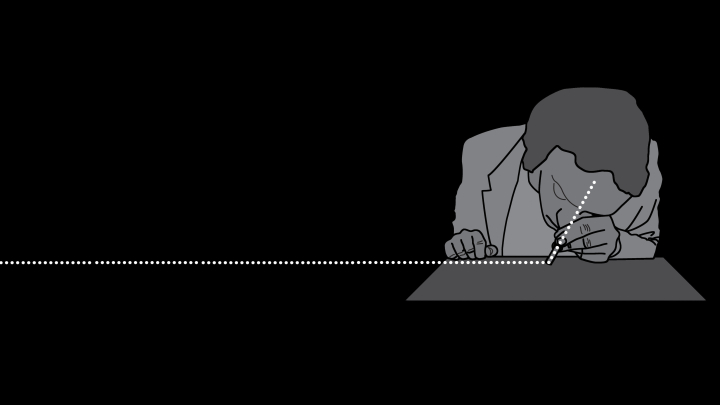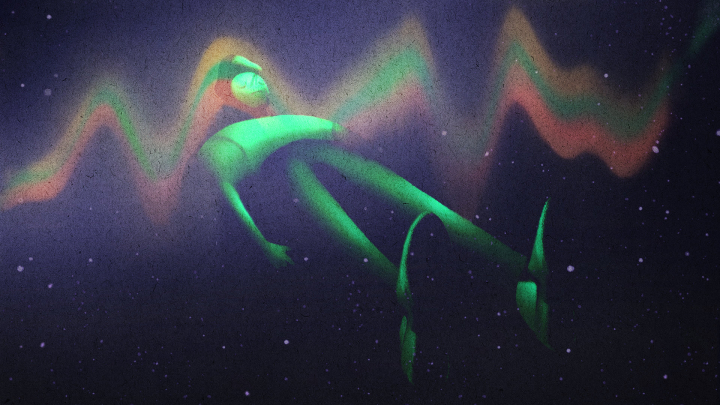Schall und Rausch
In Deutschland gibt es Hunderttausende Drogenabhängige. Die, die von dem Stoff runter wollen, trifft die Corona-Krise besonders hart

„Was wohl passiert, wenn ich mir alles auf einmal reinballere?“ Der Gedanke verfolgt Nadja seit ein paar Tagen. Sie war 14, als sie mit dem Heroin angefangen hat. Heute, wenige Jahre später, nimmt sie an einem Therapieprogramm teil, in dem Suchtpatient/-innen den Ersatzstoff Methadon erhalten. Nadja musste täglich in eine Praxis, um ihre Ration abzuholen. Bis vor drei Wochen: Wegen des Coronavirus hat die Praxis geschlossen.
Ihr Methadon hat Nadja eine Woche auf Vorrat bekommen. „Dabei will ich die Verantwortung, mir die Dosis selbst einzuteilen, eigentlich nicht haben“, sagt sie, die eigentlich nicht Nadja heißt, aber anonym bleiben möchte.
Das Bundesgesundheitsministerium zählt in Deutschland rund 600.000 Menschen mit einem „problematischen Konsum von Cannabis und anderen illegalen Drogen“. 79.400 davon nehmen an „Substitutionsprogrammen“ teil: Sie werden mit einem weniger zerstörerischen Ersatzstoff behandelt, um sich von „ihrer“ eigentlichen Droge zu entwöhnen. Die meisten Substitutionspatient/-innen werden mit Methadon, das vor allem als Heroinersatz dient, und unter Aufsicht von niedergelassenen Ärzt/-innen oder speziellen Ambulanzen behandelt.
Mit der Corona-Krise hat sich der Alltag dieser Einrichtungen verändert: Die sogenannte Take-Home-Vergabe von Substitutionsmitteln gilt normalerweise für maximal sieben Tage, wurde mittlerweile aber erhöht. So sollen die Arztpraxen entlastet und die Patient/-innen geschützt werden: Jeder Besuch in der Praxis weniger kann wichtig sein, weil viele Suchtkranke durch Lungenvorerkrankungen, Hepatitis-C- oder HIV-Infektionen selbst zu den Covid-19-Risikogruppen gehören.
„Eigentlich brauchen die Patienten unsere Hilfe in der Corona-Krise mehr denn je“
Weil der tägliche Methadongang wegfällt und sie Unterstützung braucht, verbringt Nadja ihre Zeit mit einer Freundin. Die nehme selbst an einem Methadonprogramm teil, sagt Nadja, und helfe ihr, richtig zu dosieren: das Methadon, aber auch Heroin. Denn trotz der Substitutionsbehandlung raucht Nadja wieder Heroin. „Ich bin vor einem halben Jahr rückfällig geworden“, sagt sie. Ihr Arzt weiß nichts von ihrem Rückfall, weil Nadja fürchtet, dass ihre Eltern davon erfahren könnten. Um während der Krise nicht mehr täglich das Haus zu verlassen, hat sie bei ihrem Dealer Heroin für eine komplette Woche eingekauft. „Ich wusste nicht, ob er während der Krise noch jeden Tag unterwegs ist“, sagt sie. Ihre Freundin sorge jetzt dafür, dass Nadja nicht alles auf einmal raucht. „Die Gefahr, alles auf einmal zu nehmen, wäre größer, wenn ich nicht bei meiner Freundin wäre.“
Stefanie Wessels kennt solche Sorgen, aber aus einer anderen Perspektive. Sie leitet die Ambulanz für Integrierte Drogenhilfe in Berlin-Kreuzberg und betreut normalerweise täglich Menschen, die Drogen substituieren. „Ich habe Angst, dass einige meiner Klientinnen und Klienten während der Krise wieder massiv konsumieren“, sagt Wessels. Ihre Einrichtung musste die Hilfsangebote wie viele andere stark reduzieren. „Dabei sind Krisen eigentlich die Zeit, in der die Klientinnen und Klienten unsere Hilfe stärker brauchen denn je.“

Obdachlosigkeit in Corona-Zeiten: Wir waren mit Ceil (22) unterwegs, die seit fast fünf Jahren auf der Straße lebt
Die Angebote solcher Einrichtungen geben Suchtkranken Rückhalt und – oft noch wichtiger – eine Routine. Seit die Pandemie Deutschland erreicht hat, sind nicht nur die Gruppenangebote und persönliche Betreuungsgespräche gestrichen. Auch die Tageswerkstatt in Wessels Einrichtung, in der kleine Arbeiten erledigt und Geld verdient werden kann, bleibt geschlossen. Angebote gibt es derzeit nur per Telefon oder Mail. Diese Unterbrechung des Alltags könnte viele Klientinnen und Klienten zu einem Rückfall verleiten, fürchtet Wessels. „In Situationen, die Angst machen, reagieren viele Suchtkranke mit Konsum.“ Zumal selbst die provisorische Ausgabe der Substitutionsmittel nicht gesichert sei. „Wir arbeiten gerade wie eine Vergabemaschine“, sagt Norbert Lyonn. Als Arzt in der angegliederten Praxis der Einrichtung behandelt Lyonn mehr als 300 Suchtpatient/-innen. Er macht sich Sorgen, dass jemand im Team krank wird und sie dann nicht mehr wie gewohnt arbeiten können. Schon jetzt, nach wenigen Wochen, fehlt ihnen Schutzkleidung. „Und ich weiß nicht, was mit den Patienten passiert, wenn wir oder andere Ambulanzen schließen müssen.“
Ein systematischer Ausfall der Substitutionsbehandlungen wäre fatal. Ärzt/-innen und Sozialarbeiter/-innen befürchten, dass er einen ohnehin unguten Trend bestätigen könnte: Die offizielle Zahl der Toten durch den Konsum illegaler Drogen ist in Deutschland zuletzt deutlich angestiegen. Im Jahr 2019 starben 1.398 Menschen durch illegale Substanzen, 122 mehr als im Jahr davor. Die häufigste Todesursache bleibt die Überdosierung mit Opioiden wie Heroin oder Morphin, an der 650 Menschen starben. Besonders auffällig: die Zunahme der Todesfälle von Menschen mit langjährigem Drogenmissbrauch.
„Die Gefahr für einen Rückfall war lange nicht so hoch wie jetzt“
Einigen Menschen mit einer solchen Suchtgeschichte fällt es gerade schwer, ein Verständnis für die Maßnahmen der Beratungsstellen zu entwickeln, sagt der Sozialarbeiter Sascha Jost. Er ist Einrichtungsleiter der integrativen Sucht- und Beratungsstelle Confamilia in Berlin-Neukölln, die derzeit auch versucht, den persönlichen Kontakt zu minimieren. Während viele Klient/-innen das veränderte Hilfsangebot annehmen, seien diese Menschen eine große Herausforderung: Manche von ihnen hätten kein Handy, sagt Jost, viele seien obdachlos, was die alternative Kontaktaufnahme erschwere.
Jost sieht aber nicht nur Negatives in der Krise. Sie fordere die alten Arbeitsweisen heraus: Homeoffice und Diensthandys, telefonische oder virtuelle Beratung und Therapie – all das bewilligt durch den Kostenträger – seien vor zwei Wochen noch undenkbar gewesen. „Das ist für uns Behandelnde ein Schritt nach vorn“, sagt Jost.
Innerhalb kürzester Zeit muss die Arbeit von Drogeneinrichtungen nun neu gedacht und an die dynamische Situation angepasst werden. Manche Hilfsangebote schaffen das bereits: Die Selbsthilfegemeinschaft Narcotics Anonymous zum Beispiel bietet derzeit Onlinemeetings für Menschen mit Suchtproblemen in verschiedenen Sprachen an. Klar ist, dass sich der Alltag suchtkranker Menschen verändert hat. Selbst die, die ein Handy oder einen Computer haben, müssen erst lernen, mit dem veränderten Angebot umzugehen. Suchtkranke sollten derzeit nicht alleine sein, sagt Nadja. „Die Gefahr eines Rückfalls war lange nicht so hoch wie jetzt.“
Du brauchst Hilfe oder sorgst dich um jemanden? Die Sucht- und Drogenhotline (01805 313031), die Telefonseelsorge (0800 1110222) oder das deutsche Suchthilfeverzeichnis helfen.
Titelbild: Gregory Gilbert-Lodge
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.