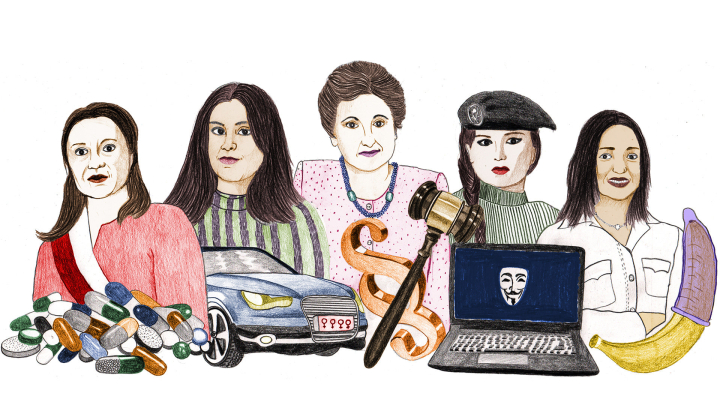Die Ruhe zwischen den Stürmen
Jahrelang wurde in Idlib im Nordwesten Syriens gekämpft. Jetzt herrscht eine brüchige Waffenruhe – und die nächste Katastrophe droht

Update, 10. Juli: Örtliche Gesundheitsbehörden melden den ersten Corona-Fall in Idlib. Ein Krankenhausarzt sei positiv auf das Virus getestet worden.
Wie ein Köder hängt die Waffenruhe über Idlib. Sie lockt die Menschen nach draußen, während sich der Rest der Welt voneinander abzuschotten versucht. „Über Monate mussten wir um unser Leben fürchten, wenn wir aus der Tür gegangen sind“, sagt Suad al-Aswad. Sie ist 44, Menschenrechtsaktivistin und lebt mit ihren sieben Kindern in Idlib. Immer wieder bricht während unseres Telefonats die Verbindung ab, bald schicken wir uns deshalb Sprachnachrichten auf WhatsApp.
„Die Menschen wollen jetzt endlich normal leben und die Freiheit genießen“, sagt Suad. 2011 wurde sie zur Aktivistin. Damals ging sie in ihrer Heimatstadt Kafranbel auf die Straße, um gegen das Assad-Regime zu demonstrieren. „Die Revolution ist eine Idee – und Ideen sterben nicht!“, schrieb sie auf ein Plakat. Aktivistin ist sie bis heute geblieben. Doch aus dem Kampf für die Revolution ist im letzten Monat ein anderer geworden: der Kampf gegen das Coronavirus.

2019 hatte die letzte Offensive des syrischen Regimes gemeinsam mit den russischen Verbündeten begonnen. Idlib war eine der ersten großen Städte, die sich 2012 von Assad befreiten. In den vergangenen Jahren war die Stadt zur „Deeskalationszone“ geworden, wohin sich Oppositionelle – dschihadistische und moderate – aus den vom Regime beherrschten bzw. rückeroberten Teilen des Landes zurückzogen. Russland und die Türkei versprachen, für ihre Sicherheit zu garantieren. Beobachter warnten schon früh, dass das Sammelbecken der Assad-Gegner eines Tages eine „Kill Box“ werden könnte – ein Ort, wo das Regime die Gegner aus allen Teilen des Landes auf einmal vernichten würde.
„Wir leben hier seit drei bis vier Jahren so, als wären Corona-Zeiten“
Viel bekam man in Deutschland nicht mit von dieser letzten großen Schlacht. Und vielleicht wäre das so geblieben, hätte nicht am 27. Februar 2020 ein Angriff der russischen Luftwaffe mindestens 33 türkische Soldaten getötet, die an der Seite der in Idlib machthabenden dschihadistischen Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kämpften. Erdoğan forderte von der EU Unterstützung im Kampf in Idlib. Als indirektes Druckmittel hatte er dabei auch die vielen Menschen in der Hand, die immer noch aus Syrien über die Türkei nach Europa flüchten wollten und bisher von der Türkei an der Grenze zurückgehalten wurden. Die EU hatte Ankara im Gegenzug Geld versprochen – der sogenannte Flüchtlingsdeal. Doch seit Monaten kritisierte der türkische Präsident, dass die Mittel nicht wie erhofft flossen.
Der Rest der Geschichte ist bekannt: Als die EU nicht auf Erdoğans Drohung, die Grenzen zu öffnen, einging, wurden Tausende Geflüchtete mit Bussen an die EU-Grenze gebracht. Hunderte berichteten, dass griechische Grenzschützer Eingereiste illegalerweise in Grenznähe zurückdrängten.
Und in Idlib? „Wir leben hier seit drei bis vier Jahren so, als wären Corona-Zeiten“, sagt Mona Bakkoor am Telefon. Die 25-jährige Journalistin arbeitet als Korrespondentin für einen kleinen Radiosender, den syrische Exilanten in Istanbul betreiben. „Die Menschen sind hungrig nach Leben“, sagt Mona. Sie genießen die Waffenruhe, die der türkische Präsident Erdoğan und der russische Präsident Putin Anfang März ausgehandelt haben. Auf Videos, die Mona mir aus Idlibs Stadtzentrum schickt: Langsam wälzen sich Autos, Minibusse und Mopeds durch die geschäftigen Straßen, Händler haben ihre Waren vor den Läden ausgestellt, Familien drängen zwischen den Marktständen hindurch. „Ihr in Europa könnt euch vor dem Virus abschotten, das ist hier nicht möglich.“ Zu Hause bleiben, das bedeute, kein Geld zu verdienen und seine Kinder nicht mehr versorgen zu können.

Sie ist wie auch die Aktivistin Suad und so viele der mehr als drei Millionen Einwohner nach Idlib geflohen: erst aus Rakka vor dem IS, dann im vergangenen Jahr vor den einrückenden Regimetruppen aus Kafranbel, einer Kleinstadt nördlich von Homs. Klein-Syrien nennen sie Idlib deshalb auch. Ein ganzes Land komprimiert auf eine Region. Während für den Rest des Landes die Zukunft entschieden scheint, sagt Mona, war sie in Klein-Syrien selten so ungewiss.
Wer ist schneller: Assad oder das Virus?
Auf Twitter und in den internationalen Medien verfolgt Mona mit Sorge, wie sich das Virus über den Erdball verbreitet. „Die meisten Menschen hier wollen es nicht verstehen“, sagt sie. Größer als die Angst vor dem Virus sei die Angst vor dem Regime. Kaum einer in der Region traue dem Putin-Erdoğan’schen Waffenstillstand. „Ich habe mindestens 20 Waffenstillstände miterlebt, die wurden jedes Mal vom Regime gebrochen.“ Mona sagt, dass sie die dschihadistischen Milizen, die jetzt – geduldet von der Türkei – die Region beherrschen, nicht unterstütze. An die Alternative zu denken, das traue sie sich gar nicht erst: „Wenn Assad nach Idlib kommt, wird es ein Blutbad geben, wie es die Welt nach neun Jahren Krieg in Syrien nicht gesehen hat.“
„Der Krieg in Syrien ist längst zugunsten des Assad-Regimes und seiner Verbündeten entschieden“, sagt der Wiener Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen, ob er in Frieden beendet werden könne. Im Gegensatz zu den kurdischen Syrian Democratic Forces (SDF) im Nordosten des Landes sei es unwahrscheinlich, dass es zwischen der HTS und dem Regime bald ein Abkommen gebe. Zum einen, weil die türkische Regierung die Gruppen in Idlib lange als Terroristen einstufte, „zum anderen, weil fraglich ist, ob sich eine dschihadistische Miliz wie Hayat Tahrir al-Sham, die früher Teil der El Kaida war, an die Waffenruhe hält.“
77 Beatmungsgeräte für drei Millionen Menschen
Ausgerechnet jetzt droht Idlib auf andere Weise zur Kill Box zu werden. NGOs warnen vor einer Katastrophe. Nicht wegen des Krieges – sondern wegen des Virus. Offiziell zählt das Assad-Regime in Syrien 43 Corona-Fälle und drei Tote (Stand 29.4.2020). In Idlib ist noch keiner bekannt. In der gesamten Region gibt es laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) für mehr als drei Millionen Menschen nur 46 Beatmungsgeräte für Erwachsene, 31 für Kinder. Außerdem gebe es laut Munzer Khalil vom Idlib Health Directorate im gesamten Nordwesten Syriens nur 200 Intensivbetten. Durch die Luftangriffe in den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Krankenhäuser zerstört, viele Ärzte und Pfleger bei Angriffen auf Krankenhäuser entweder getötet oder sind geflohen.

Im Gegensatz zum Rest der Welt gibt es in Idlib keinen Staat, der Corona-Maßnahmen durchsetzen könnte. „Die Regierung hier hat keinen Plan von dem, was sie tut“, sagt Aktivistin Suad al-Aswad. Zwar seien die Schulen geschlossen, Märkte, Kaffeehäuser und Restaurants aber weiterhin geöffnet. Es gebe niemanden, der sich zuständig fühle. „Vor ein paar Wochen hieß es: ‚Das Freitagsgebet in der Moschee ist untersagt‘ – dann kam eine andere militärische Gruppe und meinte: ‚Nein, das könnt ihr nicht machen.‘“
„Wir haben die Bomben überlebt, was soll denn das jetzt?“
Für die Aktivistin Suad steht fest: Wenn die Regierung nichts tut, dann muss eben die Zivilbevölkerung handeln. So sei es 2011 gewesen, als sie gegen das Assad-Regime auf die Straße ging; so sei es auch 2012 gewesen, als sie mit ihren Freundinnen nach der Befreiung der Stadt Kafranbel gegen den Willen der Männer ein Frauenzentrum errichtet habe, ebenso wie später, als sie den dschihadistischen Gruppen zum Trotz Workshops für Frauen angeboten und ihnen ihre Rechte erklärt habe.
Zusammen mit anderen geflohenen Aktivistinnen aus ihrer Heimatstadt Kafranbel hat sie deshalb vor einigen Tagen Flyer gedruckt: „Covid-19 – Was ist das Coronavirus?“, steht darauf geschrieben. Auf einem Foto, das sie mir schickt, sieht man Suad gemeinsam mit anderen Aktivistinnen mit OP-Masken und Gummihandschuhen bekleidet. Mit Pappkartons voller Seife und Desinfektionsmittel, die die Aktivistinnen mithilfe von Spenden der deutschen Initiative „Adopt a Revolution“ gekauft haben, stehen sie in einem Flüchtlingslager zwischen Baracken aus Sperrholz und Zeltplanen vor einer Menschentraube.
„Natürlich haben die Leute erst mal gesagt: ‚Wir haben unter Bomben gelebt, wir haben den Krieg überlebt, was soll denn das jetzt?‘“ Sie habe daraufhin geantwortet: „Wenn euch euer Leben lieb ist und ihr nicht wollt, dass eure Kinder ohne Eltern aufwachsen, dann hört jetzt gut zu!“
Titelbild: picture-alliance / dpa
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.