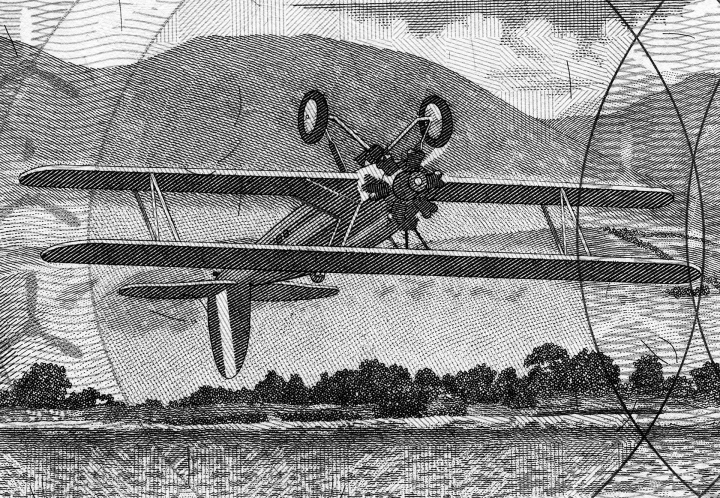Immer diese Privilegierten
Luisa ist 25 und hat ein Eliteinternat besucht. Hier erzählt sie, was an den Vorurteilen über die Reichenbubble dran ist
Schuluniformen, Rugbyteams, Tennisplätze und abends heimliche Drogenpartys – ganz so, wie das Leben in einem Eliteinternat in Filmen oft dargestellt wird, ist es nicht. Klar lebt man in einer Seifenblase, aber man bekommt auch nicht alles geschenkt. Es gibt jede Menge Verpflichtungen und Regeln. Zum Beispiel gibt es wöchentliche Drogentests, bei denen ausgelost wird, wer seinen Urin testen lassen muss. Wenn der Test positiv ist, fliegt man sofort von der Schule. Auch das Abi bekommt hier niemand hinterhergeworfen.
Klar, die Privatschule, auf die ich ging, kostet schon mehrere Zehntausend Euro im Jahr. Daher ist das Umfeld ein anderes als auf staatlichen Gymnasien. Autos sind zum Beispiel ein krasses Statussymbol und fallen auf dem Schülerparkplatz sofort ins Auge. Von seinen Eltern eine Mercedes-Benz G-Klasse geschenkt zu bekommen ist ganz normal.
Mein Golf war mit Abstand das kleinste Auto. Und trotzdem waren die meisten meiner Mitschülerinnen und Mitschüler auch ziemlich uneitel. Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen spielten Äußerlichkeiten bei uns kaum eine Rolle. Meistens sind wir nur in Jogginghosen rumgelaufen, auch wenn wir das eigentlich im Unterricht nicht durften.
„Natürlich gab es auch die, die über Pfingsten mit ihren fetten Autos nach Sylt fuhren und da im Club mit Champagner rumgespritzt haben“
Viele aus meiner Familie waren auf demselben Internat. Es hat also eine gewisse Tradition in meiner Familie. Das ist bei vielen Schülerinnen und Schülern so. Man kennt sich häufig schon vorher über die Familien. Es herrscht eine Art Klüngel. Viele kamen auch aus Adelsfamilien. Sie wurden die „Adelsgang“ genannt. Den meisten von uns war schon bewusst, dass es ein großes Privileg ist, auf dieses Internat zu gehen. Das wurde uns auch von der Schule vermittelt. Aber natürlich gab es auch die, die über Pfingsten mit ihren fetten Autos nach Sylt fuhren und da im Club mit Champagner rumgespritzt haben. Das entspricht voll den Vorurteilen, die viele haben. Aber nicht allen meinen Mitschülerinnen und Mitschülern wurde das Geld in den Hintern gesteckt. Viele Eltern mussten viel dafür arbeiten, um ihren Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. An dere wiederum hatten das Gefühl, dass sie den Lebensstandard ihrer Eltern unbedingt halten und dafür besonders hart arbeiten müssen. Das bedeutet auch Druck. Dabei hilft es selbstverständlich, dass man sich eine Art Netzwerk im Internat aufbaut. Alle unterstützen sich, auch die ehemaligen Schülerinnen und Schüler.
Eine lange Tradition haben am Internat die sogenannten Gilden – das sind soziale Verpflichtungen, die jeder Schüler und jede Schülerin übernehmen muss. Wir konnten uns zum Beispiel im Seniorenheim um ältere Menschen kümmern oder sozial benachteiligten Jugendlichen Nachhilfeunterricht geben. Auch in Ruanda gab es ein Projekt auf einer Kaffeeplantage. Mein Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeiten hat sich dadurch schon in der Schulzeit entwickelt, auch wenn mir die Gegensätze zwischen Arm und Reich erst nach der Schule stärker aufgefallen sind, weil wir auf dem Internat unter uns waren. Heute studiere ich Psychologie und merke, dass ich auch an der Uni privilegiert bin, weil meine Eltern mich während des Studiums finanziell unterstützen. Andere müssen nebenbei viel arbeiten. Es ist mir zudem bewusst geworden, welche Unterschiede es beispielsweise bei den Leistungen der gesetzlichen und privaten Krankenkassen gibt. Das macht die Schere zwischen Reich und Arm besonders deutlich.
Titelbild: Martin Parr/Magnum Photos/Agentur Focus
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.