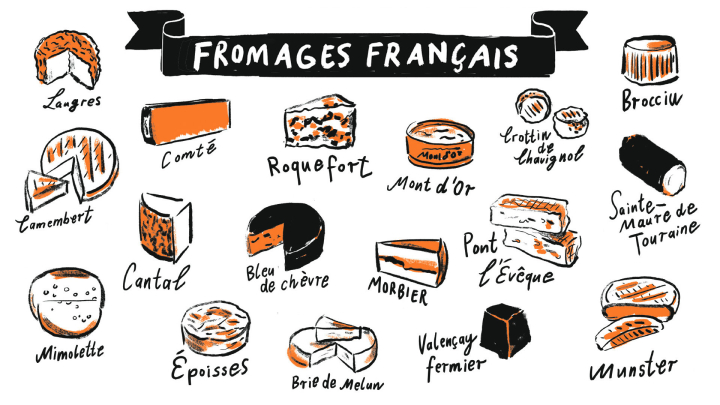Taschenliebe
Wenn es um edle Mode und Kosmetik geht, sind französische Firmen nicht zu schlagen. Louis Vuitton, Chanel und Hermès – sie alle versorgen die Welt mit schönen Dingen
Eine hochpreisige Designertasche, entworfen, um darin exakt fünf Champagnerflaschen zu transportieren – wahrscheinlich gibt es wenige Dinge, die Luxus besser verkörpern als „Noé“. Die Tasche ist einer der Klassiker der Marke Louis Vuitton. Der Ledersack baumelt genauso an den Schultern berühmter Schauspielerinnen wie auch an denen sehr unberühmter Passantinnen in deutschen Fußgängerzonen. Und das, obwohl die Tasche mit den Schaumweinmaßen nicht gerade ein Schnäppchen ist. Im Onlineshop des französischen Unternehmens kann man die Noé für einen Preis von etwas über 1.000 Euro bestellen.
Luxusgüter wie Ledertaschen, Kaschmirschals und brillantbesetzte Uhren können einen arm machen. Manch einen in Frankreich haben sie dagegen unglaublich reich werden lassen: Fünf der sechs wohlhabendsten Franzosen verdanken ihr Vermögen dem Geschäft mit dem Edlen, Feinen und Besonderen. Etwa Bernard Arnault, der Chef des weltweit größten Luxusgüterkonzerns LVMH, zu dem neben Louis Vuitton auch die Marken Christian Dior und Givenchy gehören. Noch reicher als Arnault ist nur die greise L’Oréal-Erbin Liliane Bettencourt: Das Unternehmen hat seine Milliarden nicht nur mit Drogerieshampoo, sondern auch mit Kosmetik und Parfum von Herstellern wie Lancôme, Biotherm und Cacharel erwirtschaftet. Zu den prestigeträchtigsten Marken der anderen Superreichen zählen Chanel, Yves Saint Laurent und Balenciaga. Französische Luxusgruppen wie LVMH und Konkurrent Kering haben zudem auch ausländische Labels aufgekauft, unter anderem Gucci, Bulgari und Marc Jacobs.
Warum denn nicht: mal eben ein Schmuckstück für ein Abendessen
Man könnte das Nobelmarken-Namedropping noch eine Weile fortsetzen (all die Champagnersorten!), denn: Französische Unternehmen sind weltweit Marktführer im Luxussegment. Entsprechend wichtig ist die Luxusindustrie für die französische Wirtschaft. Allein in Frankreich beschäftigt sie etwa 200.000 Menschen. Noch dazu wird die Branche immer lukrativer, denn mehr und mehr Kunden können und wollen sich Luxus leisten. Die Unternehmensberatung Bain & Company prognostiziert bis 2020 weltweit rund 400 Millionen Luxuskonsumenten.
Warum sind gerade französische Unternehmen in diesem Geschäft so erfolgreich? Ein Teil der Antwort besteht darin, dass die Liebe zum Luxus zur französischen Kultur gehört – und die Konzerne dieses kulturelle Erbe und Lebensgefühl gut vermarkten können. „Natürlich gibt es nicht den Franzosen“, sagt der Kulturwirt und Frankreichforscher Christoph Barmeyer von der Universität Passau. „Aber ab einem gewissen Einkommen leisten sich Franzosen eher mal eine ‚petite folie‘, eine kleine Verrücktheit.“
Der Juwelier und Schmuckdesigner René Talmon L’Armée hat den gleichen Eindruck. Er beobachtet in seinen Läden in Berlin und Paris, dass sich französische Kunden besonders genussvoll für eine Kette oder ein Paar Ohrringe entscheiden. „Franzosen kaufen auch mal ganz schnell ein Schmuckstück, etwa für ein besonderes Abendessen“, erzählt Talmon L’Armée. „Da soll dann zum Outfit noch der passende Schmuck her.“
Um diese Freude am Luxuriösen zu verstehen, hilft ein Blick in die Vergangenheit, auf das prunkvolle Leben am Hof von Versailles. Dort nahmen die Höflinge auf Kloschüsseln aus Mahagoni Platz, und weil Waschen mit Wasser damals verpönt war, überdeckten die feinen Damen unangenehme Gerüche mit besonders viel Puder und Parfum. Königin Marie Antoinette war zudem ein ausgemachtes „Fashion Victim“. Sogar ihr mit 3,6 Millionen Francs ohnehin schon recht üppiges Jahresbudget für Kleidung reichte nicht ganz für ihren exquisiten Geschmack. Ihre Majestät gönnte sich einfach zu gern mit Saphiren und Diamanten verzierte Roben.
Luxus war nicht nur ein dekadentes Vergnügen der Adligen, sondern genauso ein profitorientiertes Geschäft
Luxus war aber auch damals nicht nur ein dekadentes Vergnügen der Adligen, sondern genauso ein profitorientiertes Geschäft. Eines, das die Staatskassen mit ausländischem Geld füllen sollte. Der Finanzminister von Louis XIV. – dem „Sonnenkönig“ –, Jean-Baptiste Colbert, förderte Manufakturen, die nicht nur den Hof mit hochwertigen Waren wie Porzellan und feinen Stoffen beliefern, sondern auch für den Export produzieren sollten.
So entstand nicht nur eine positive Handelsbilanz, sondern auch eine handwerkliche Tradition: Viele der heute führenden Luxusmarken wurden im 18. und 19. Jahrhundert von kunstfertigen Handwerkern begründet, die den Hof mit den schönsten und edelsten Dingen versorgten. Louis Vuitton beispielsweise fertigte das Reisegepäck für Kaiserin Eugénie, Einpackservice inklusive. Diese Tradition und Handwerkskunst beschwören die französischen Nobelmarken noch heute, um das Gefühl der Exklusivität zu vermitteln und ihre hohen Preise zu rechtfertigen.
So richtig exklusiv sind all die beseelten Handtaschen und Schmuckstücke allerdings nicht mehr – vom Preis mal abgesehen. Schon allein, weil Exklusives für die Massen ein Widerspruch in sich ist. Die Firmen haben seit Langem eine zweite Zielgruppe neben den wirklich gut Betuchten im Blick: die Mittelschicht, die sie mit logoübersätem Bling-Bling und massenhaft produzierten Accessoires und Kosmetik locken. Wer sich noch nicht die Armbanduhr leisten möchte oder kann, bekommt als Einstiegsdroge eben eine Sonnenbrille oder einen Lippenstift. Von einer „Demokratisierung des Luxus“ ist da gern die Rede. Das klingt schön. In erster Linie handelt es sich aber um eine knallharte kapitalistische Strategie zur Gewinnmaximierung.
Chinesen sind die wichtigsten Kunden für Luxuswaren, die teilweise billig bei ihnen produziert werden
Denn längst werden die Luxuskonzerne nicht mehr von Handwerkern, sondern von betriebswirtschaftlich denkenden Geschäftsmännern wie LVMH-Chef Bernard Arnault geführt. Von dem stammt übrigens auch das bezeichnende Zitat, dass die Luxusgüterindustrie der einzige Bereich sei, in dem man Luxusmargen erzielen könne. Der Gewinn, den die Marken beispielsweise mit Handtaschen erzielen, ist in der Regel zehn bis zwölf Mal so hoch wie die Produktionskosten. Bei Arnaults Zugpferd Louis Vuitton beträgt er sogar das Dreizehnfache.
Möglich werden solche Profite, weil die Manager vieler Häuser massiv Kosten reduzieren. Die Marken steigen auf günstigere Materialien um, schneidern Ärmel grundsätzlich einen guten Zentimeter kürzer, um Stoff zu sparen – und verlegen Teile der Produktion aus dem teuren Westeuropa in Länder wie China. Damit man trotzdem ein Etikett mit „Made in France“ oder „Made in Italy“ einnähen kann, wird dort zumindest ein „wesentlicher“ Produktionsschritt vorgenommen. Ausnahmen wie Hermès – das Unternehmen setzt im Gegensatz zu vielen Konkurrenten auf traditionelle Produktionsweisen und Handarbeit wie anno 1837 – bestätigen die Regel.
Apropos China. Die Chinesen sind, aller Luxusliebe der Franzosen zum Trotz, längst die wichtigsten Kunden: Rund 100 Milliarden Euro haben sie 2015 für Luxusprodukte ausgegeben, was 46 Prozent des weltweiten Umsatzes in diesem Segment entspricht. Zum Shoppen französischer Nobelmarken pilgern sie gern nach Paris. Dort reihen sich die chinesischen Touristen dann an den Champs-Élysées geduldig vor der Louis- Vuitton-Filiale ein und stehen Schlange wie beim Textildiscounter.
Titelbild: Daniel Zucchnik/Getty Images