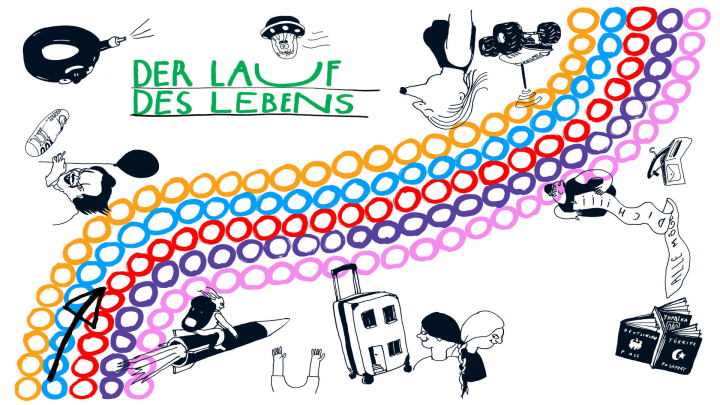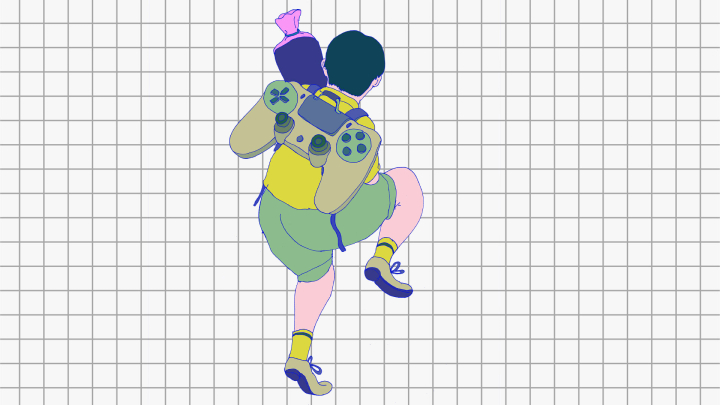„Das ganze Leben ist ein Spiel“
Beim Spielen geht es nicht nur ums Abschalten und Spaßhaben, es lehrt uns noch viele andere wichtige Dinge im Leben – unter anderem: es nicht so schwerzunehmen. Der Spielwissenschaftler Jens Junge erklärt, wie das gelingen kann

fluter: Herr Junge, auf meine Anfrage, dass so ein fluter-Heft zum Thema Spiele nicht ohne Sie und die Ludologie auskäme, haben Sie eher irritiert reagiert: Spielen sei doch Kinderkram.
Jens Junge: Das war natürlich kokett. Wir müssen das Spielen ernst nehmen. Wir Ludologen kämpfen permanent gegen die Vorurteile an, Spielen sei Zeitverschwendung oder Realitätsflucht. In unserer protestantischen Ethik, die Arbeit zur Verpflichtung und zum Lebensmittelpunkt macht, darf erst spielen, wer richtig was weggeschuftet hat. Dabei merkt irgendwann selbst der größte Schleifer, dass Kreativität und Veränderungsbereitschaft nicht nur aus Fleiß erwachsen.
„Das Spielen ist eine der wenigen anthropologischen Konstanten“
„Der Mensch (...) ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, wusste schon Friedrich Schiller. Erlischt dieser angeborene Spieltrieb irgendwann?
Nein, nein, das Spiel endet erst mit dem Tod.
Deadlines, Einkaufslisten und Rechnungen: Erwachsene haben häufig andere Dinge im Kopf als Spiele.
Ich muss vor einem zu engen Verständnis von Spielen warnen. Nehmen Sie Berufstätige, die im Büro so viel sitzen, dass sie sich abends eben nicht dem Videospiel, sondern dem Bewegungsspiel im Fitnessstudio widmen. Manche gehen fürs Schauspiel ins Kino, andere lesen fremder Leute Gedankenspiele in einem Comic. Das Spielen ist eine der wenigen anthropologischen Konstanten, wir können gar nicht ohne. Das ganze Leben ist ein Spiel!

Wirklich? Das ganze Leben?
Ist so. Der Begriff stammt aus dem Mittelalter: „Spil“ steht im Althochdeutschen für Tanz, für Bewegung. So verwenden wir ihn im Deutschen bis heute, denken Sie an das Spiel der Wolken oder Wellen. Alles, was in Bewegung und Veränderung ist, ist ein spielerischer Prozess.
Viele denken bei Spielen weit weniger philosophisch: an Regeln, an ein Spielfeld, ans Gewinnen.
Das Englische unterscheidet immerhin noch zwischen play und game. Play beschreibt das kindliche, erkundende, freie Spiel, game dessen regelbasierte Variante. Die kann sehr viel mehr Facetten haben als Regeln. Zum Beispiel Ambivalenz: Jedes Fußballspiel lebt von der Spannung, dass wir nicht wissen, wie es ausgeht. Spiele haben oft Feedbacksysteme: Wer hat wie viele Punkte, wer das höhere Level? Oder das Symbolhandeln, ein chronisch unterschätztes Merkmal vieler Spiele: Wir tun so, als ob ...
... ist ja nur ein Spiel.
Eben: unernst. Aber kein Kinderspiel! Wir üben dabei andere Rollen, Muster und Normen, wir werden variabler. Spielen ist eine Methode: Mit den künstlichen Herausforderungen des Spiels machen wir die realen begreifbar, um verschiedene Strategien auszuprobieren. Für Gewohnheitstiere wie den Menschen ist das elementar.
„Wie ich mich verhalte, hängt auch von meiner Spielbiografie ab: Bin ich offen für neue Lösungen? Vertrage ich Verluste, oder schmeiß ich dann das Spielbrett um?“
Weil?
Es bequemer ist, mit dem, was wir uns einmal draufgeschafft haben, immer durchzukommen. Da wird, frei nach dem Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick, die Lösung schnell zum Problem. Schauen Sie nur auf die Klimakrise: Wir brauchen nichts dringender als Ideen, wie wir in wenigen Jahren kein CO2 mehr ausstoßen. Alle sind gefragt, ihr Konsumverhalten zu ändern. Ob ich das kann, hängt von meiner Spielbiografie ab: Bin ich offen für neue Lösungen? Finde ich selber welche? Vertrage ich Regeländerungen und Verluste, oder schmeiß ich dann das Spielbrett um?
Mit Spielen denken wir Gesellschaft anders. Das war schon beim „Skat“ so.
Als „Skat“ im frühen 19. Jahrhundert erfunden wurde, war das eine Revolution, weil das Spiel den Adel absetzte: Der König hat nichts mehr zu melden, der Bauer gibt Trumpf an. Diese Machtumkehr ist wesentlich für viele Spiele, da müssen Sie gar nicht bis in die Aufklärung zurück. Sie sehen das bei jedem Kind, das seine Eltern im „Memory“ schlägt. Kinderhirne sind visuell viel leistungsstärker als die durchverdrahteten Gehirne der Eltern, die schon an den Einkauf oder das nächste Meeting denken. Und plötzlich erfahren Kinder Selbstwirksamkeit: Moment, ich schlage gerade den, der mir immer sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Da dreht sich das Machtverhältnis innerhalb der Familie.


Gab es Epochen, in denen das Spiel eine ganz andere Bedeutung hatte als heute?
Es gab immer wieder dunkle Zeiten für Spiele. Im Mittelalter zum Beispiel war die katholische Kirche eine Spielverderberin sondergleichen. Die hat das Spielen verteufelt: Gottes großer Plan, seine Wahrheit sollte nicht durch eigene Regeln infrage gestellt werden. Da sind selbst ernannte „Retter des christlichen Abendlandes“ losgezogen, um auf den Marktplätzen Kartenspiele und Würfel zu verbrennen. Andererseits haben Religionen Spiele lange als Propagandainstrumente genutzt.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Das, was wir heute als „Mensch ärgere dich nicht“ kennen, entsprang einem Spiel, das ein britischer Kolonialherr aus Indien mitgebracht hat: „Pachisi“. Der Gedanke: Das Leben ist Mist, wir erleben Rückschläge und Schmerzen, sterben und werden wiedergeboren, immer mit dem Ziel, im schmerzfreien Nirwana anzukommen. Heute denkt kein Mensch mehr beim „Mensch ärgere dich nicht“ ans Sterben. Spiele können ihre Funktion verlieren und in anderen gesellschaftlichen Kontexten als Kulturgut weiterexistieren.
„Im Mittelalter hat die katholische Kirche das Spielen verteufelt. Gottes großer Plan sollte nicht durch eigene Regeln infrage gestellt werden“
Spielen Menschen in anderen Kulturräumen anders?
Absolut. Studien zeigen, dass sich die kulturellen Merkmale einer Gesellschaft in ihren Spielen ausdrücken. In tendenziell egalitären sogenannten Wir-Gesellschaften zum Beispiel wird schon im Kindesalter eher kooperativ, also miteinander gespielt als in wettbewerbsorientierten Gesellschaften.
In Deutschland gilt immer noch „Siedler“ als Institution.
Wir sind eine Sicherheitskultur. Der Rasen gehört auf Länge, das Geld zur Sparkasse, und auch auf dem Spielbrett soll’s hübsch ordentlich zugehen. Wir wollen aufbauen, konstruieren, vorwärts, aufwärts, weiter, und dafür bitte dauernd vom Spiel belohnt werden. US-Amerikaner dagegen kultivieren das Risiko, da irritieren Chaos, Verlust und Zufall weniger. Das gesetzlose „SimCity“ gilt als Sehnsuchtsort, alles andere darf Godzilla abreißen.
Ist Spielen immer kreativ, oder kann es auch ins Gegenteil umschlagen?
Wenn ich mich derart einfangen lasse, dass ich süchtig werde, ist das für einen kreativen Umgang mit Herausforderungen eher hinderlich. Dann schadet mir das Spielen.

Sie sind dereinst von der Realschule geflogen, weil Sie zu viel gespielt haben.
Ich saß in der letzten Reihe und habe Comics gezeichnet. Oder „Fix und Foxi“ gelesen. Bis mir meine Deutschlehrerin das Heft abnahm und es vor der Klasse zerriss. So ein Schund gehöre nicht in die Schule, sagte sie.
Mit solchem Kulturdünkel haben Spiele bis heute zu kämpfen. Vielen gilt das Wegsuchten selbst mittelmäßigster Fernsehserien als rege Teilhabe am Kulturleben – während sie das Spielen komplexer Games mit mitleidigen Blicken quittieren.
Wer Games heute als trivial und Zeitverschwendung bezeichnet, hat keine Ahnung von ihrer Vielfalt. Als das Radio kam, dachte man auch, die Zeitung geht unter, und als es Fernsehen gab, hielt man Grabreden aufs Radio. Das ist Mediengeschichte.
Was empfehlen Sie?
Die eigenen Spiele hartnäckig verteidigen und vor allem nicht denkfaul sein: Alle diese Kulturformen können nebeneinanderstehen und sich ergänzen. Meine geliebten Comics haben es aus der Nische geschafft. Graphic Novels werden heute die neunte Kunst genannt.
Warum braucht das Spielen mit der Ludologie einen eigenen Forschungszweig?
Die Wissenschaft verharrt zu sehr in ihren Disziplinen: Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Anthropologie, Wirtschaftswissenschaften, Informatik, die schauen sich das Spielen alle für sich an. Die Ludologie könnte als transdisziplinäres Fach auf die Zusammenhänge schauen. Bislang ist das alles private Initiative. Wir haben eine Sammlung in Altenburg aufgebaut: 42.000 Brettspiele, 25.000 Kartenspiele, ein paar wissenschaftliche Mitarbeiter. Ich will daraus eine staatlich finanzierte Lehr- und Forschungssammlung machen, die dem Thema Spiel als Kulturgut gerecht wird.
„Arbeitsteilung und Globalisierung haben uns auf ein Wohlstandsniveau gebracht, das es uns erlaubt, mehr zu spielen als früher“
Zumal man den Eindruck haben könnte, wir spielen mehr als je zuvor?
Die These würde ich unterschreiben. Arbeitsteilung und Globalisierung haben uns auf ein Wohlstandsniveau gebracht, das es uns erlaubt, viel zu spielen. Spielen trägt nicht unmittelbar zu unserer Existenzerhaltung bei.
Spielen ist Luxus?
Wir müssen sicher sein und satt, diesen Freiraum braucht das Spiel.
Wissen wir eigentlich immer, dass wir spielen?
Schauen Sie sich Staatsverschuldungen an. Oder die weltweite Geldmenge. Die meisten Menschen leben im Glauben, dass dieses Geld irgendwas wert sei, dass es einen Gegenwert habe. Aber das globale Finanzsystem ist eine Konstruktion, nichts als ein großes Glücksspiel, von dem wir tagtäglich hoffen müssen, dass sich alle an die Regeln halten. Wir leben in vielen solcher Spielfelder, ohne uns dieser ausgedachten Ordnungen dauerhaft bewusst zu sein.
Die Einsicht, dass viele der Ordnungen um mich herum erfunden sind und damit veränderlich, könnte entspannen. Muss man das Leben spielerischer nehmen?
Bitte! Wer zu sehr auf der Unveränderlichkeit der Dinge besteht, kann andere sogar gefährden. Manche halten – meinetwegen in bester Absicht – so viel auf ihre Normen, Einstellungen und Werte, dass sie andere Menschen ablehnen, wenn die sie nicht teilen. Die werden über ihrer Spiel- und Regeltreue unmenschlich. Ich rate also sehr dazu, sich immer mal wieder zu fragen: Welches Spiel spielen wir hier eigentlich gerade? Und sich nicht zu sehr an die Regeln zu binden.
Ist Schummeln erlaubt?
Natürlich, das gehört zu jedem Spiel dazu.

Jens Junge ist Verlagskaufmann und Comiczeichner. Er hat schon Onlinegames entworfen, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, und ist irgendwann in die Spielwissenschaft gegangen. Nun ist er Direktor des Instituts für Ludologie an der SRH Berlin University of Applied Sciences. (Foto: Justus Junge)
Dieser Beitrag ist im fluter Nr. 87 „Spiele“ erschienen. Das ganze Heft findet ihr hier.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.