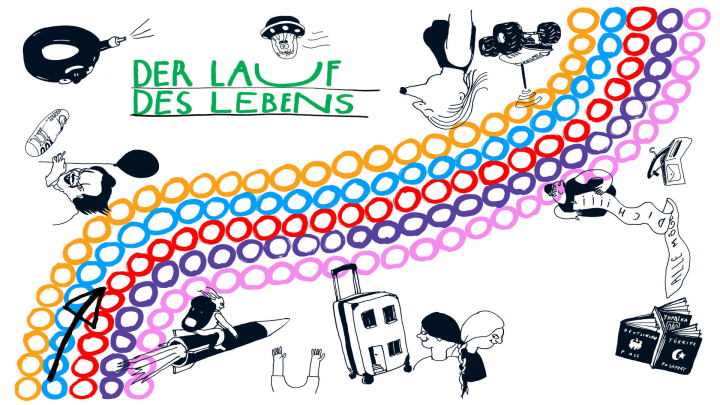Wer kommt denn auf so was?
Wie erfindet man Brettspiele, und kann man davon leben? Besuch bei einem, der sich schon Dutzende ausgedacht hat

„Lebst du nur, oder spielst du schon?“, fragt ein Schild an einem Haus in Mönchengladbach. Drumherum strahlen die Gesichter bunter Spielfiguren, an der Wand lehnt ein Lastenrad, durch die Glastür ist ein Kicker zu sehen. Und gerade als man in dieser Kita nachfragen will, ob und wohin das Büro Mücke verzogen sei, öffnet ein Mitarbeiter die Tür. Und mit ihr das Lager.
In Regalen stapeln sich rote und blaue Aufbewahrungsboxen, in jedem Winkel, bis unter die Decke. Darin: Autos und Schiffe, Pinguine und Zebras, Sterne und Edelsteine. Spielsteine verschiedener Größen, Farben und Formen. Würfel mit sechs, acht, zwölf oder noch mehr Seiten, blank, mit aufgedruckten Ziffern oder Symbolen. Dazwischen Spielkartons. In seinem verwinkelten Lager hält Harald Mücke alles bereit, was ein gutes Spiel braucht.
Reich wird man als Spieleautor äußerst selten
Mücke ist 55 und einer der wenigen, die ihre Leidenschaft fürs Spielen zum Beruf machen konnten. 2000 ist er das erste Mal als Spieleautor auf Messen. Als studierter BWLer sieht er schnell eine Lücke im Markt: Es gibt niemanden, der das Material, das Autorinnen und Autoren für die Spiele brauchen, als Einzelteile anbietet. „Ich habe gemerkt, dass ich selber Spielteile produzieren muss, damit ich meine Spiele hinkriege. Das war nie geplant, sondern tatsächlich mehr oder weniger erzwungen.“ Mücke gründet einen Materialversand für Spielutensilien und einen Verlag. Fortan bastelt er nicht mehr nur im Keller, sondern zieht in ein Büro und bedient von dort eine wachsende Nachfrage – sowohl mit Material als auch mit eigenen Spielkreationen. Aus seinem Hobby wird ein Vollzeitjob.
Dass er das geschafft hat, ist nicht selbstverständlich. Spiele zu entwickeln ist kein Ausbildungsberuf, kein geschützter Titel und wenig lukrativ. „Der Standardvertrag von Verlagen sieht vor, dass Autorinnen und Autoren sechs Prozent vom Handelspreis erhalten“, sagt Mücke. Ein Durchschnittsspiel verkaufe sich zwei- bis dreitausendmal. Die Einnahmen für die Autorinnen und Autoren sind gering. Für die meisten bleibt das Spieleerfinden ein Hobby.


Die Spiele-Autoren-Zunft (SAZ) versucht, das zu ändern. Sie vertritt die Interessen vieler deutscher, aber auch internationaler Spieleautorinnen und -autoren und bietet rechtlichen Beistand. Mücke saß dem Verein mal vor. Dass die Autorinnen und Autoren eines Spiels heute auf den Schachteln genannt werden, hat er miterkämpft.
Noch etwas ändere sich gerade auf dem Markt, sagt Mücke. „Durch die Automatisierungsprozesse ist vieles günstiger geworden. Wenn ich jetzt als Anfänger ein Spiel machen möchte, kriege ich das mit 5.000 Euro hin und arbeite dann für die eigene Kasse. Nicht für die großen Verlage. Da mag schon mal mehr hängen bleiben.“
Mücke hat, das ist wohl Voraussetzung, schon als Kind gern gespielt. Dabei packte ihn manchmal der Drang, mehr aus einem Spiel zu machen. Für sein erstes Spiel nahm Mücke eine Korkwand, pinnte Planeten drauf und verband sie mit einem Faden. Er taufte es „Galaktische Kooperative“. Die Wand hängt bis heute in seinem Büro. Produziert wurde das Spiel nie: Mit der sperrigen Pinnwand und den spitzen Reißzwecken wäre der Versand des Materials zu aufwendig gewesen.
Umwelt- und Kooperationsspiele gehen gerade gut
Die Umsetzbarkeit ist ein Kriterium, auf das auch Verlage achten müssen. Einmal habe ein Autor bei ihm ein Spiel eingereicht, für das man zwei Kilo Sand benötigt, erzählt Mücke. Zudem geht auch in der Spielindustrie der Trend zur Nachhaltigkeit. Vor allem was die Verpackung angeht, die Schachtel und die Spielmaterialien. Aber auch thematisch: „Spielen hilft ja immer, Sachen auf positive Weise zu transportieren. Umweltthemen gehen dann natürlich gut.“
Auch Mücke stellt sich dahingehend um. In seinem Lager sind mittlerweile fast alle Spielfiguren aus Holz. Sein Verlag pflegt einen kleinen Firmengarten, verschickt Ware in alten Kartons und Folien und kauft größeren Häusern Spiele ab, die in hoher Stückzahl produziert wurden, aber gefloppt sind. Damit schreibt er seit Jahren Wettbewerbe aus, in denen Autorinnen und Autoren aus den alten Spielsets ein neues Spiel entwerfen müssen. So können Spielmaterialen wiederverwendet werden.
Neben dem Thema Umwelt liegen gerade Kooperationsspiele im Trend – also miteinander spielen, nicht gegeneinander. Auf so eine Welle springen schnell viele auf, sagt Mücke. „Da versucht einer mal was Neues, und wenn es funktioniert, rennt die ganze Branche hinterher.“ Manche Runs seien schnell wieder vorbei, denn ein Rezept für Bestseller gebe es nicht.


Viele Spiele, die heute Klassiker sind, hatten es anfangs schwer. Die „Siedler von Catan“ lehnten zwei große Verlage ab, als der Autor das Spiel 1994 anbot. „Siedler“ wurde bis heute mehr als 35 Millionen Mal verkauft und begründete den Erfolg der sogenannten Eurogames, strategische Brettspiele, die zu einem deutschen Exportschlager wurden. In vielen dieser Spiele geht es um Expansion und den Kampf um Ressourcen. Sie sind in den vergangenen Jahren in die Kritik geraten, weil sie das Leid, das durch den Kolonialismus entstanden ist, verharmlosen würden.
Auch Mücke kennt Verlage, bei denen es Vorwürfe gab, weil Spielfiguren als rassistisch empfunden wurden. Heute versuche man schon, „manche Dinge zu vermeiden und dafür aktiv Themen wie Diversität reinzubringen“, sagt er.
Wenn Mücke etwas erklärt, zeichnet er gerne auf, was er meint. Mit schnellen Strichen skizziert er das Spielbrett des Spiels, an dem er gerade arbeitet. „Die Idee kam mir nach einer Wahl.“ Es geht um Lobbyisten und Parlamentarier, die kooperieren müssen, um an die Macht zu kommen, aber auch konkurrieren, um Einfluss auf die Gesetzgebung auszuüben. „Ich habe versucht, diesen Prozess vereinfacht darzustellen.“
Die Regeln dürfen nicht zu kompliziert sein
Gerade bei solch komplexen Spielen seien die Regeln oft das größte Hindernis. Vielen Spielerinnen und Spielern dauert es zu lange, bis sie die Regeln verstanden haben und losspielen können. Auch dafür suchen Autorinnen und Autoren Lösungen. Zum Beispiel mit Begleitvideos auf YouTube, unterschiedlichen Regeln für die ersten und darauffolgende Partien oder Regeln, die so aufgebaut sind, dass man direkt loswürfeln kann und das Spiel beim Spielen lernt.
Solche Herausforderungen ziehen Mücke nicht runter, ein Spieleautor muss lösungsorientiert denken. Damit aus einer Idee ein Spiel wird, brauche er neben Kreativität und logischem Verständnis auch den Biss, das Spiel reif zu machen. „Wenn man jahrelang an einem Spiel herumbastelt, hört der Spaß irgendwann auf.“
Seine Ideen entwickelt Mücke oft vom Material her. Heißt: Er nimmt sich etwas aus seinen Regalen, spielt rum, würfelt mögliche Kombinationen aus. Bei manchen Spielen geht es schnell. „Ein einfaches Kartenspiel mit wenig Tiefgang ist schnell zu Ende gedacht. Dann setzt der Illustrator das um, und ich bin in einem Monat fertig.“
Für andere, die Schwergewichte, braucht er schon mal zwei, drei Jahre. Je komplexer die Verknüpfungen, desto mehr muss Mücke testen. Wirft man ein Spiel zu schnell auf den Markt, leidet die Logik. Ein Spiel muss in jeder Situation funktionieren, für jede Spielerzahl, für jede Strategie. Ein Spieler dürfe nie wissen, wie er spielen muss, um zu gewinnen, sagt Mücke. „Dann ist das Spiel tot.“
Dieser Beitrag ist im fluter Nr. 87 „Spiele“ erschienen. Das ganze Heft findet ihr hier.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.