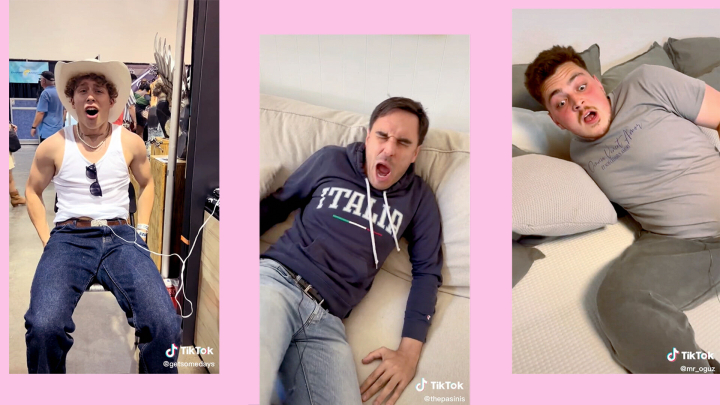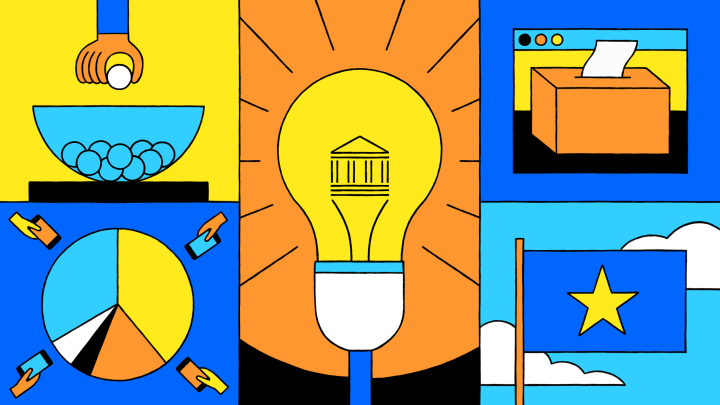Thema:
Demokratie
Wie geht politisches Engagement?
Wir haben fünf Tipps – und mit Nanna-Josephine Roloff gesprochen, die mit einer Petition Menstruationsprodukte günstiger gemacht hat
Film: Jasmin Weiner
12. Januar 2023
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.