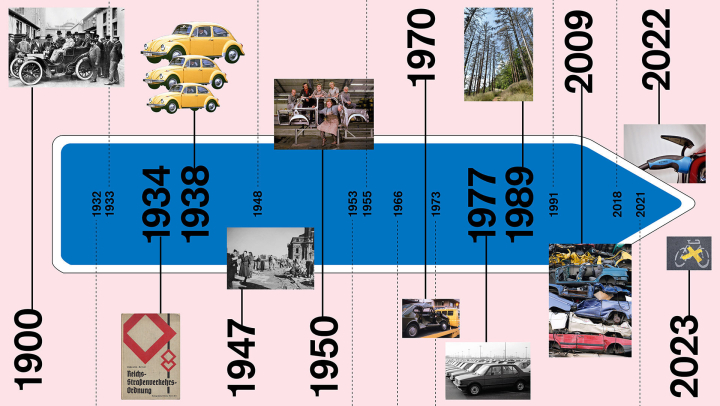PS I love you
Das erste Auto ist mehr als ein Verkehrsmittel

„Ich habe den Opel erst seit ein paar Tagen. Da stecken viele Erinnerungen drin, weil er früher meinen Eltern und meinem Opa gehört hat. Ein eigenes Auto ist totaler Luxus für mich: Der Führerschein ist sündhaft teuer, und auch die Kosten, um ein Auto zu kaufen und zu unterhalten, sind deutlich gestiegen. Dafür kann ich jetzt spontan an den See fahren oder mal eben aufs Festival. Das war vorher viel umständlicher. Vor dem Verkehr in Berlin habe ich großen Respekt. Ich will das Auto möglichst selten nutzen und viele Fahrten teilen. Unsere Mobilität muss nachhaltiger werden und flexibler, mit besseren Öffis und mehr Carsharing-Möglichkeiten. Ich merke aber auch, dass viele Menschen im eigenen Auto ein Statussymbol sehen.“
Liia, 27, aus Berlin (Titelfoto)
-------------------------------------------------------
„Mit dem eigenen Auto kommt Verantwortung: Ich muss mich um das Fahrzeug kümmern, auch finanziell“

„Hier hält der Bus zweimal am Tag, selber Auto fahren ist ein Riesending für mich. Ich könnte spontan zu Freunden fahren, mitten in der Nacht zu McDonald’s oder vom Feiern wieder nach Hause. Den Führerschein ab 16, so wie in vielen Bundesstaaten in den USA, finde ich sinnvoll, damit weniger junge Menschen darauf angewiesen sind, dass ihre Eltern sie rumfahren. Ich mache gerade Fahrschule und glaube, das kann auch mit 16 funktionieren: Die Fahrstunden sind sehr intensiv, die Anforderungen an Fahrschüler hoch. Auf lange Sicht will ich in die Stadt ziehen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrad fahren, vielleicht später mal ein Elektroauto kaufen. Ich schätze die Freiheiten, aber sehe natürlich die Nachteile, was die Umwelt betrifft. Mein Auto ist alt und fährt mit Benzin. Und mit dem eigenen Auto kommt Verantwortung: Ich muss mich um das Fahrzeug kümmern, auch finanziell. Für meinen VW Golf habe ich mein Erspartes zusammengekratzt, für den Führerschein arbeite ich nebenbei.“
Nele, 17, aus Wegeleben in Sachsen-Anhalt
-------------------------------------------------------
„Das Auto gehörte meinem Vater, ich habe es ihm über drei Jahre abbezahlt. Besonders stolz bin ich auf den Innenraum, die Felgen und das Fahrwerk“


„Meinen Führerschein hab ich seit November und das Auto, seit ich 14 bin. Das hat früher meinem Vater gehört, ich fand es schon immer toll und habe es ihm über drei Jahre abbezahlt. Besonders stolz bin ich auf den Innenraum, die Felgen und das Fahrwerk. In Zukunft werden wohl vor allem autonome Autos unterwegs sein. Das sind keine schönen Aussichten: Autofahren ist doch Spaß, eine Leidenschaft, auf jeden Fall mehr als ein Transportmittel. Mit dem Auto finde ich es viel entspannter als mit der Bahn oder zu Fuß.“
Jeremy, 18, aus Fredersdorf in Brandenburg
-------------------------------------------------------
„Ich sehe es als Privileg, als Frau einen Führerschein machen zu können. Das ist ja nicht überall selbstverständlich“

„Mein Freund und ich leben in einem Wohnmobil. Das ist eher Lifestyle als Verkehrsmittel, wir fahren spontan an schöne Orte und Seen oder in den Urlaub. Ich sehe es als Privileg, als Frau einen Führerschein machen zu können. Das ist ja nicht überall selbstverständlich. Mir gibt es ein Gefühl von Selbstbestimmung und Freiheit. Trotzdem würde ich gern öfter aufs Auto verzichten. Ich hoffe, dass das öffentliche Verkehrsnetz ausgebaut wird und wir mehr Carsharing nutzen, damit sich die Zahl der Autos insgesamt reduziert. In Städten nehme ich eh oft die Öffentlichen. Beim Führerschein mit 16 bin ich skeptisch: Jüngere Menschen sind oft risikobereiter. Die aktuelle Regelung, mit 17 unter Aufsicht fahren und erst mit 18 alleine, finde ich sinnvoller.“
Clara, 26, aus Michendorf in Brandenburg
-------------------------------------------------------
„Das Auto ist schneller und angenehmer als jede Bahn. Ich kann laut Musik hören und meine Kumpels mitnehmen“


„Ich wollte schon als Junge Auto fahren, jetzt kann ich es endlich. Das Auto ist schneller und angenehmer als jede Bahn. Ich kann laut Musik hören und meine Kumpels mitnehmen. Auf der Autobahn halte ich die Spur und fahre, fahre, fahre. Das befreit die Gedanken. Aufs Auto würde ich nur verzichten, wenn ich getrunken habe oder andere Drogen im Spiel sind. Sonst nicht. Es heißt ja, Jüngere wollen Elektroautos und Ältere an ihren Verbrennern festhalten. Aber E-Autos sind gar nicht mein Ding, ich liebe den Sound und das Fahrerlebnis von Benzinern. Zum Tuning bin ich durch Kumpels und Autotreffen gekommen. Und durch meinen Vater. Der hatte früher einen Mercedes 190, aber der ist mir zu teuer. Also habe ich mir einen W202 zugelegt, Baujahr 1996 und ein paar Macken, aber die habe ich mit meinem Vater repariert. Er hat mir beigebracht, wie man an Autos schraubt. Ich wollte immer ein Auto, das cool aussieht und das ich selbst aufmotzen kann.“
John, 17, aus Berlin
-------------------------------------------------------
Dieser Beitrag ist im fluter Nr. 92 „Verkehr” erschienen. Das ganze Heft findet ihr hier.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.