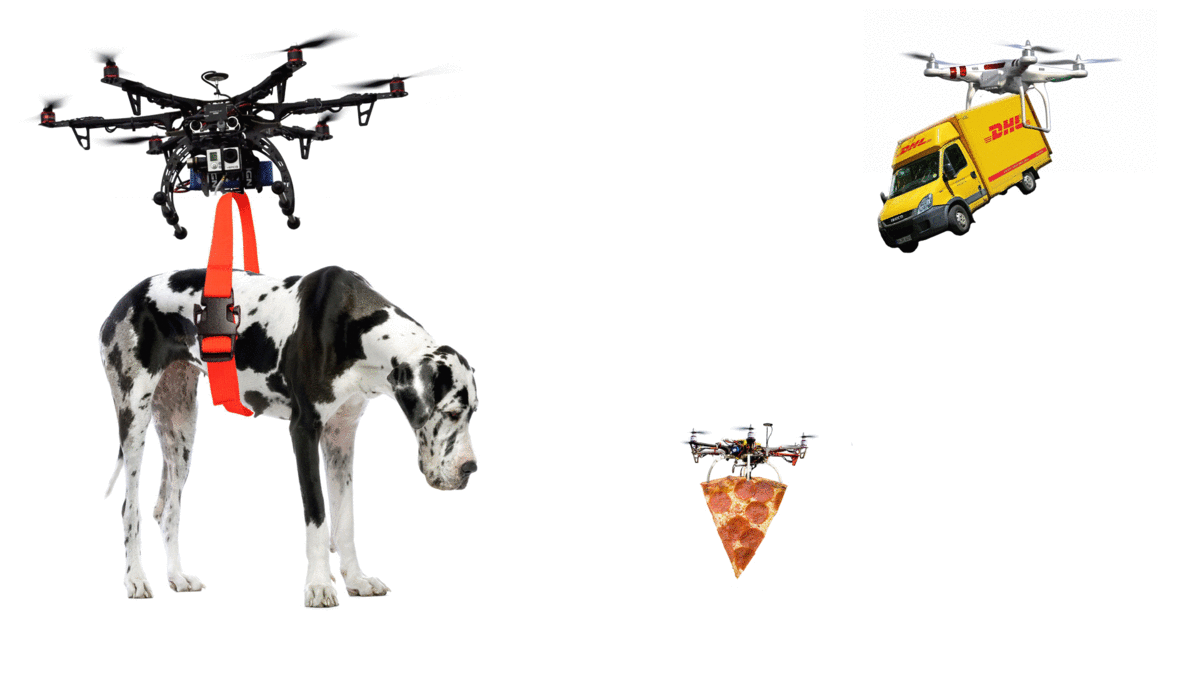Kopf hoch
Malariaschub, Schlangenbiss, Durchfallepidemie: In Ghana fallen die Medikamente in der Not oft vom Himmel

Das bekannteste Verkehrsmittel in Ghana ist zweifellos das Trotro: ein oft klappriger Minibus, den die Menschen zu jeder Tages- und Nachtzeit als Sammeltaxi nutzen. Man drängt sich darin auf engen Sitzbänken, kommt ins Gespräch und wird auf den Straßen voller Schlaglöcher gemeinsam durchgerüttelt.
Seit fünf Jahren macht in Ghana aber ein anderes Transportmittel Schlagzeilen, eins, das sich weder von schlechten Straßen aufhalten lässt noch von den häufigen Überschwemmungen oder dem undurchdringlichen Regenwald: Drohnen.
Mit ihnen werden in dem westafrikanischen Land dringend benötigte Medikamente transportiert – und zwar fast überallhin. Gerade in den schwer zugänglichen Gebieten haben sich die Menschen an den Anblick und die Geräusche gewöhnt. Erst liegt ein Summen in der Luft, dann ein lauter werdendes Brummen, schließlich taucht der unbemannte Flieger aus den Wolken und wirft ein Paket mit Fallschirm ab. Wie eine Apotheke am Himmel.
Mittlerweile fliegt über Ghana die größte Drohnenlieferflotte der Welt. Betrieben wird die von einem kalifornischen Unternehmen: Zipline. Der Staat stellt die Medikamente, Zipline lagert, liefert aus und stellt die Rechnung. 2024 wird die staatliche Gesundheitsagentur GHS für die Lieferungen mindestens 70 Millionen Cedi aus Krankenversicherungsbeiträgen ausgeben, umgerechnet rund vier Millionen Euro. Wie viel Zipline insgesamt verdient? Darüber schweigt das Unternehmen. Fakt ist: Es dürfte in Zukunft noch mehr werden, Zipline will weitere Drohnenflughäfen in Ghana bauen.
600 Lieferungen per Drohne gibt es täglich im Schnitt
Derzeit gibt es sechs. Der in Vobsi, im dünn besiedelten Norden des Landes, sieht aus wie ein kleiner Provinzflughafen. Ein Bildschirm zeigt die Drohnen, die in der Luft sind: Was haben sie geladen, haben sie schon geliefert, wie hoch ist der Ladestand der Akkus? Nebenan inspizieren Mitarbeiter Drohnen, die von Touren zurückgekehrt sind, beladen andere mit Medikamenten aus dem Lager und schieben sie auf eine Art Abschussrampe. Ein bisschen wie beim Start einer Rakete, nur ohne Turbinen, die Drohnen fliegen an die 120 Stundenkilometer schnell und bis zu 160 Kilometer weit.
Derzeit liefert Zipline rund 160 Produkte aus, darunter Blut- und Plasmakonserven, Impfstoffe, Antiseren gegen Schlangengift oder Glukosepulver gegen Durchfallerkrankungen. Die Bestellungen gehen über Anrufe, SMS oder WhatsApp in einer Zentrale ein, die sie an den nächstgelegenen Drohnenflughafen weiterleitet. Nach dem Abschuss weist ihnen die zivile Luftfahrtbehörde eine Route zu. Wenige Minuten vor dem Ziel sendet die Drohne eine Nachricht an die Ärzte, sich in der „Drop-Zone“ einzufinden. Dort wirft sie das Päckchen mit einem Papierfallschirm ab und fliegt zurück zur Packstation. Durchschnittlich 600 Lieferungen fliegen so täglich über Ghana.

Was bestellt wird, variiert. In der Covid-Pandemie versorgte Zipline weite Teile des Landes mit Schnelltests und Impfstoffen. In den Erntezeiten sind eher Antiseren gefragt, weil sich auf den Feldern die Schlangenbisse häufen. Und bald ist wieder Regenzeit, ideale Brutbedingung für Mücken, dann gehen massenhaft Malariamedikamente in die Luft.
Gerade in Notfällen sind die Drohnen effizient. Sie erreichen rund 2.500 Gesundheitseinrichtungen in weniger als einer Stunde. Das spart Zeit in einem Land, in dem viele Straßen nicht befestigt und regelmäßig überschwemmt sind. Zeit, die Leben retten kann, wenn es gerade keinen Krankenwagen gibt, der Patienten in eine Klinik bringt. Oder wenn sie dringend eine Bluttransfusion brauchen. Früher mussten in den ländlichen Gegenden meist Verwandte Blut spenden.
Macht Ghana sich vom Hersteller Zipline abhängig?
Doch es gibt auch Kritik. Derzeit ist der Betrieb auf Notfalllieferungen beschränkt: Mehrere Kliniken sollen mit den Drohnenlieferungen ihre Lager aufgefüllt haben, statt Patienten zu versorgen. 2023 ordnete der damalige Gesundheitsminister Kwaku Agyeman-Manu an, die Drohnenaktivitäten genauer zu erfassen.
Für die Bevölkerung sind die Drohnen eine große Hilfe. Für Zipline sind sie ein Exportgut, das Gewinne machen soll. Das Unternehmen will künftig auch Privatpersonen und Kleinbauern beliefern und arbeitet mit Ghanas Marine zusammen, die eine eigene Drohnenflotte für Such- und Rettungseinsätze aufstellen will. Manche fürchten, Ghana könnte sich von Zipline abhängig machen und wegen dessen bequemer „on demand“-Medizin seine staatliche Vorsorge vernachlässigen. Das Land versucht seit geraumer Zeit, ein stabiles staatliches Gesundheitssystem aufzubauen. Heute sind knapp 70 Prozent der Bevölkerung krankenversichert, der Schutz umfasst aber nur eine Grundversorgung in bestimmten Gesundheitseinrichtungen. Es fehlt an Ärzten, Blutkonserven und Krankenhausbetten, gerade in ländlichen Gebieten. Probleme, die selbst die größte Drohnenlieferflotte nicht lösen kann, die aber unter ihr leicht übersehen werden.
Titelbild: Ruth McDowall/AFP via Getty Images – flyzipline.com
Dieser Beitrag ist im fluter Nr. 92 „Verkehr” erschienen. Das ganze Heft findet ihr hier.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.