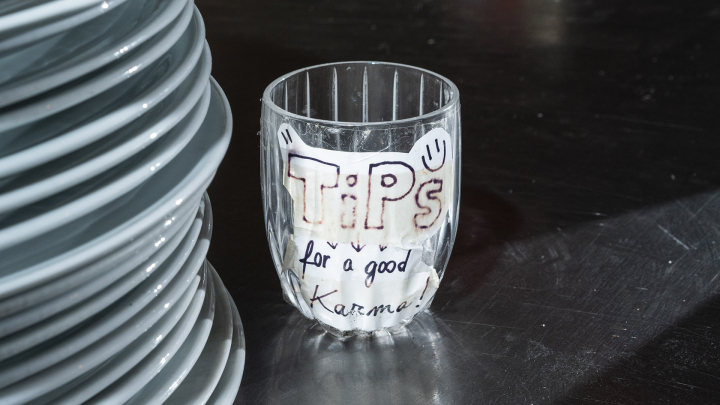„Trinkgeld ist eine Ursache großer Unsicherheiten“
Wieso geben wir Trinkgeld, und warum ist uns die Entscheidung über die Höhe oft ein wenig unangenehm? Das hat der Soziologe Christian Stegbauer erforscht
fluter.de: Herr Stegbauer, gemeinsam mit Studierenden haben Sie die soziologische Dimension des Trinkgeldzahlens im Gastronomiebereich untersucht. Wie kamen Sie denn gerade auf dieses Thema?
Christian Stegbauer: Also, weil ich unter anderem Wirtschaftssoziologie lehre, lese ich in der Zeitung immer auch den Wirtschaftsteil. Dabei stoße ich mich regelmäßig daran, wie Wirtschaftswissenschaftler die Welt erklären, denn das ist mit der Soziologie oft nicht gut vereinbar. Und das betrifft auch die Frage, wie man mit Trinkgeld umgeht beziehungsweise warum man überhaupt Trinkgeld gibt.
Was sagen die Wirtschaftswissenschaftler so dazu?
Die haben ein ziemlich einfaches Weltbild: Man macht nur etwas, wenn es einem nutzt. Doch gibt man ein Trinkgeld ja hinterher und nicht vorher. Was nutzt es einem dann noch?
Könnte man nicht sagen, die Bedienungen gehen besser mit einem um, weil sie erwarten können, dass sie Trinkgeld kriegen? Das wäre ein Nutzen.
Stimmt. Aber Trinkgeld ist freiwillig. Die Bedienungen können nicht wissen, ob sich ihre Freundlichkeit lohnt. Nein, Trinkgeld ergibt aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht nur dort Sinn, wo man regelmäßig hingeht. Aber in einer Autobahnraststätte, in die man nur einmal im Jahr oder im Leben kommt? Da hat man selbst überhaupt nichts davon, trotzdem machen es viele Leute. Und das ist genau der Punkt, wo wir in der Soziologie genauer hinschauen und uns fragen: Was sind dafür die Gründe?
Warum geben wir denn dann Trinkgeld?
Die wohl geläufigste Erklärung ist: Wir geben Trinkgeld als Belohnung. Für ein gutes Essen, für eine gute Bedienung, für Aufmerksamkeit, all so was. Und wenn es uns nicht gefallen hat, dann geben wir weniger oder kein Trinkgeld. Das ist der Standardansatz, und es gibt sicher Gäste, die es genauso handhaben.
„Denn Trinkgeld ist längst so etwas wie eine Institution, das heißt: In gewissen Situationen wird einfach erwartet, dass man Trinkgeld gibt“
Aber nicht alle?
Nein, bei weitem nicht. Denn Trinkgeld ist längst so etwas wie eine Institution, das heißt: In gewissen Situationen wird einfach erwartet, dass man Trinkgeld gibt. In Deutschland mindestens in Restaurants mit Bedienung. Dort gibt man es oft einfach aus einer kulturellen Eingeübtheit und lässt sich auch von Erwartungen lenken.
Das Trinkgeld als soziale Norm. Dabei fangen die Unklarheiten ja schon bei der Höhe an …
Genau. Von den Studierenden in meinem Seminar hatte ein ganz ordentlicher Anteil – übrigens alles Frauen – selbst mal in der Gastronomie gearbeitet. Auf die Frage, wie hoch das Trinkgeld sein sollte, haben die sich gemeldet und gesagt: Das ist doch klar, 10 Prozent! Bloß meinten die Gäste, die wir interviewt haben: Na ja, eher so 5 bis 10 Prozent, oder man rundet auf. Es ist also alles nicht so eindeutig festgelegt, und deswegen ist Trinkgeld auch eine Ursache für große Unsicherheiten. Das führt zu Aushandlungsprozessen auf drei Ebenen: zwischen Gast und Bedienung, zwischen den Gästen untereinander und, was man vielleicht oft nicht so bedenkt, auch auf der Seite der Gastgebenden.
Sie meinen Fragen wie: Gibt es einen Topf für alle, damit niemand benachteiligt wird?
Wir haben für unsere Forschungsarbeit Interviews mit etwa 20 Bedienungen aus ganz verschiedenen Gaststätten, Restaurants und Cafés geführt. Wie dort das Trinkgeld aufgeteilt wird, ist fast immer anders. Mal kommt es der Bedienung direkt zugute, mal wandert es in einen Topf. Dann kann es passieren, dass der Schichtleiter das Geld verteilt. Manchmal kriegen die Azubis dabei weniger, oder der Leiter sagt: Also, du bist besonders viel gerannt, du verdienst heute mehr als die anderen. Es kommt auch vor, dass die Köche ebenfalls beteiligt sind – oder das Küchenpersonal kriegt einen Euro mehr pro Stunde, um das fehlende Trinkgeld auszugleichen. Eine Kellnerin berichtete uns übrigens, dass sie gewisse Gäste – etwa ausländische Touristengruppen –, von denen sie wenig Trinkgeld erwartet, gezielt in den Bereich einer Kollegin platziert.
Weil Trinkgeld nach gesellschaftlich ausgehandelten Regeln funktioniert, wird es in verschiedenen Gesellschaften auch verschieden gehandhabt. Wohl am markantesten ist die Lage in den USA: Hier sind die Löhne für das Servicepersonal oft sehr niedrig, das Trinkgeld ist kein Bonus, sondern elementar, und zwar eher eines im Bereich 15 bis 20 Prozent. Ein Wert, der aktuell steigt, ausgelöst durch die Coronapandemie und unterstützt durch den Einsatz von Kreditkartenlesegeräten mit Trinkgeldvorschlägen (siehe Kasten „Trinkgeld ohne Bargeld“). Zudem wächst auch die Zahl der Tätigkeiten, für die ein Trinkgeld erwartet wird – das Ergebnis ist eine „Tipflation“, die in den USA heftig diskutiert wird. In den meisten europäischen Ländern kommt man mit den in Deutschland üblichen 10 Prozent hingegen gut durch. In Skandinavien – außer Schweden – ist der Service bereits in der Rechnung enthalten. Trinkgeld ist unüblich oder beschränkt sich darauf, ein kleines Wechselgeld liegen zu lassen. In ostasiatischen Ländern wie Japan und China kann Trinkgeld sogar als unhöflich gelten, wobei sich das in China in touristenorientierten Bereichen aktuell ändert.
Sie sprachen von Unsicherheiten. Die meisten gibt es da wohl im Verhältnis zwischen Gast und Bedienung?
Ja. Manche Gäste haben sich deshalb eine Routine zurechtgelegt und geben immer das gleiche Trinkgeld. Egal, was passiert, egal, ob es gut oder schlecht war. Eine wichtige Frage ist dabei auch: Wie wird das Trinkgeld überreicht? Manchmal gibt es so ein Kästchen oder eine Mappe, in die man das Bargeld reinlegen kann. Da hat man ein wenig Zeit, um zu rechnen und zu entscheiden, und ist relativ frei – oder jedenfalls freier, als wenn die andere Person vor einem wartet und das Geld direkt an sich nimmt oder das Kartenlesegerät in der Hand hält. Das kann eine ganz andere Erwartung erzeugen. Hinzu kommt ein weiterer Grund, warum die direkte Trinkgeldübergabe vielen Leuten peinlich ist: Sie wollen sich nicht über die andere Person erheben und sie nicht abwerten.
Das Trinkgeld als Machtdemonstration?
Es kann eine sein. Ich habe selbst während meines Studiums als Minibarverkäufer bei der Bahn gearbeitet. Da kostete der Kaffee 3,90 Mark, und ich war immer halb beleidigt, wenn die Kunden dann nur vier Mark gegeben haben und dabei noch ganz gönnerhaft taten. Allerdings: Mehrere Servicekräfte haben uns auch berichtet, dass sie von Menschen, die weniger Geld haben, auch ein geringeres Trinkgeld erwarten.
Es wird immer mehr mit Karte oder mobilen Geräten gezahlt, und das verändert auch die Trinkgeldkultur. Einfach das Rückgeld mit einem „Stimmt so!“ zum Trinkgeld machen fällt weg. Bei der bargeldlosen Zahlung kann das Trinkgeld leichter vergessen werden – diese Vermutung lasse sich laut dem Wirtschaftswissenschaftler Sascha Hoffmann von der Hochschule Fresenius in Hamburg auch mit Studien belegen. Mittlerweile schalten daher viele Kartenlesegeräte eine Auswahl vor mit drei Trinkgeldvorschlägen – beispielsweise 5, 10 und 15 Prozent. Manchmal kann man auch die Möglichkeiten „Kein Trinkgeld“ oder „Freie Eingabe“ auswählen. Das ist praktisch für alle, die nicht gerne kopfrechnen, gefällt aber nicht allen Kundinnen und Kunden: Manche fühlen sich unter Druck, vor den Augen der Bedienung auf „Kein Trinkgeld“ zu drücken, selbst wenn es „nur“ ein Tresenverkauf war. Zudem gibt es den psychologischen Effekt des „Hangs zur Mitte“. Sind alle drei Vorschläge hoch angesetzt – etwa 10, 15 und 20 Prozent –, tendieren einige zu 15 Prozent, selbst wenn sie normalerweise nur 10 Prozent geben würden.
Kommen wir zur letzten Ebene: Wie verhalten sich die Gäste untereinander?

Christian Stegbauer, 64, ist Professor für Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sein Schwerpunkt ist die Netzwerkforschung; er hat unter anderem Arbeiten zu Wikipedia und zu Shitstorms veröffentlicht.
Das ist aus soziologischer Sicht ebenfalls spannend. Wir haben Gruppen gesehen, die regelmäßig zusammen ausgehen. Die entwickeln ihr gemeinsames Zahlungssystem, bei dem auch das Trinkgeld irgendwie integriert ist. Zahlt in einer Gruppe aber jeder für sich, dann kriegt man ja mit, was die vor einem gegeben haben. Ist das viel, kann der soziale Druck steigen. Zahlt wiederum einer besonders wenig, wird manchmal die „Schande“ für die Gruppe von anderen ausgeglichen. Und von einem Mann wurde uns berichtet, dass seine Frau ihm unter dem Tisch gegen das Schienbein getreten habe, als er nach ihrem Empfinden dabei war, zu viel Trinkgeld zu geben.
Aua! Wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal Trinkgeld gegeben – und wie viel?
Gestern, in einem Restaurant in der Pfalz. Die Rechnung war so bei 35 Euro, das habe ich mit Karte gezahlt, und drei Euro Trinkgeld in Münzen hingelegt. Die hatte ich zum Glück noch im Portemonnaie.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.
Titelbild: Hahn&Hartung