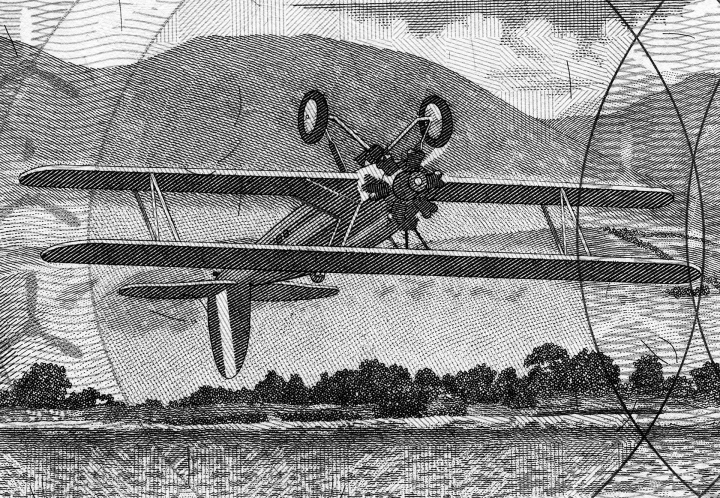„Die Bedeutung der Nation wird zunehmen“
Ist es wichtig, dass man deutsch ist? Und was ist mit Deutschsein überhaupt gemeint? Sauerkraut lieben und Goethe lesen? Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler über einen schwierigen Begriff
fluter: Herr Münkler, sind Sie Deutscher?
Herfried Münkler: Ja. Ich bin ein Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland, das zeigt ein Blick in meinen Pass. Zudem ist meine Familie – soweit ich meine Herkunftslinien kenne – seit langer Zeit im deutschen Raum angesiedelt.
Sind Herkunft und Pass die entscheidenden Faktoren, die einen Menschen zum Deutschen machen?
Nicht unbedingt. Es gibt ja sehr viele, die aus anderen Räumen nach Deutschland gekommen sind und dennoch Deutsche sind. Die lange Zugehörigkeit zu diesem Raum und seiner Kultur ist keine Voraussetzung der Zugehörigkeit. Ein wichtiges Element, um Deutscher zu werden, ist aber die Bereitschaft, sich mit der Geschichte des Raums und seinen Gepflogenheiten zu beschäftigen.
Was sind denn deutsche Gepflogenheiten?
Da bewegt man sich schnell im Bereich der Klischees. Vielleicht kann man es am allerbesten herausfinden, indem man etwa Türken, die lange in Deutschland gelebt haben, beobachtet, wenn sie in der Türkei sind. Was ihnen dort fehlt, ist ein guter Indikator dafür, wie deutsch sie geworden sind. So haben sie beispielsweise eine gewisse Erwartung an Pünktlichkeit oder Akkuratesse.
„Wenn wir nur unter unseresgleichen sind, stellen wir uns gar nicht erst die Frage, wer wir sind“
Bilden wir also Identitäten, indem wir zwischen dem Eigenen und dem Anderen unterscheiden?
Identitätsbildung von individueller bis zu kollektiver Identität ist ein ständiger Prozess des Hin und Her. Wer wir sind, erfahren wir durch die Beobachtung der Anderen, die wiederum uns beobachten. Deshalb fordert uns das Ankommen der vielen Flüchtlinge auch heraus. Allerdings – das darf nicht übersehen werden – entsteht ein Bewusstsein von Identität gerade dann, wenn man mit solchen Herausforderungen konfrontiert wird. Wenn wir nur unter unseresgleichen sind, stellen wir uns gar nicht erst die Frage, wer wir sind. Der Andere oder der Fremde nötigt uns dazu, dass wir erstens darüber nachdenken, wer wir sind, zweitens, wer wir sein wollen, und drittens, wer wir sein können. Und das ist ein Jungbrunnen für jede Gesellschaft.
Inwiefern ein Jungbrunnen?
Ein Gemeinwesen muss sich immer wieder erneuern, sonst vermodert es. Zur Erneuerung des Gemeinwesens hat zum Beispiel die Wiedervereinigung beigetragen oder eben jetzt die massenhafte Zuwanderung. Wenn wir solche Herausforderungen annehmen und bestehen, gibt das Selbstvertrauen und Zuversicht.
Könnten gerade die Zugewanderten diejenigen sein, die ein „Wir-Gefühl“ in Deutschland auslösen?
So ist es. Wenn die Integration gelingt, hat sich die deutsche Gesellschaft angesichts eines großen Problems bewährt, und das eint. Diejenigen, die grundsätzlich gegen Zuwanderung sind, sind nicht zukunftsfähig. Sie verhindern jede Erneuerung und jeden Fortschritt.
Die Gegner der Zuwanderung warnen vor dem Verlust einer kulturellen Identität. Was ist damit gemeint?
Vernünftig hat das noch keiner beantworten können. Wenn man damit Goethe oder Schiller meint, dann ist das keine nationale Inklusion, sondern ein bildungsbürgerliches Projekt. Auch über die Essgewohnheit lässt sich keine Nation machen, denn es mögen nicht alle Sauerkraut und Rippchen. Außerdem verändert sich die kulturelle Identität immer wieder. Nehmen Sie zum Beispiel die Überwindung der konfessionellen Differenzen. Heute ist es ohne Weiteres möglich, dass ein Protestant eine Katholikin heiratet. Das ist ein wesentliches Element bei der Modernisierung dieses Landes gewesen. Insofern kann ich eine kulturelle Identität nur im Grundgesetz sehen und darin, dass wir zu dessen Werten stehen.
„In den 1950er- und 1960er-Jahren wollten viele angesichts der nationalsozialistischen Verbrechen lieber keine Deutschen sein“
Jahrzehntelang hatten besonders junge Menschen in Deutschland ein Problem mit einem Bekenntnis zur Nation, weil dieser Begriff durch den Nationalsozialismus pervertiert wurde.
In den 1950er- und 1960er-Jahren wollten viele angesichts der nationalsozialistischen Verbrechen lieber keine Deutschen sein. Hinzu kam, dass die Nation ohnehin politisch geteilt war. Das änderte sich erst mit der Wiedervereinigung, als es wieder eine Vorstellung davon gab, dass die Nation eine politische Gestalt als Staat bekommen hat. Ab da mussten die Deutschen wieder anfangen, sich zu definieren.
Hat das geklappt? Oder wird unter der „deutschen Identität“ in Ostdeutschland etwas anderes verstanden als in Westdeutschland?
Das Problem war, dass die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte in Westdeutschland eine ganz andere war als in Ostdeutschland. In der DDR sah man sich als „Sieger der Geschichte“, der Nationalsozialismus wurde vor allem hinsichtlich der Dimension Kapitalismus versus Sozialismus behandelt, die Dimension des Rassismus blieb außen vor. Die intensive Beschäftigung mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten und deren Verbrechen wurde in Westdeutschland hingegen zu so etwas wie der geschichtspolitischen Staatsräson und entsprechend in den Schulen unterrichtet. Das hat sich ausgezahlt, zum Beispiel in einer höheren Populismusresistenz. Man weiß, welche Folgen bestimmte Formen des Ausgrenzens und des Sichselbst- Erhöhens haben, während unsere Nachbarländer, weil sie ja nicht das Tätervolk waren, immer ein gutes Gewissen hatten. Das Wahlverhalten in Sachsen ähnelt also nicht ohne Grund eher dem in Polen als dem im Westen. Und nicht ohne Grund sind im Osten bei der Bestimmung von Identität viel eher ethnische Vorstellungen im Spiel als im Westen.
35 Prozent der Schüler und Studenten fühlen sich am meisten mit ihrer Stadt beziehungsweise Region verbunden. 24 Prozent mit ihrem Land, 12 mit Europa
Identifizieren sich nicht ohnehin viele Menschen in Deutschland eher mit den Regionen, aus denen sie kommen?
Deutschland ist ja nie ein zentralistischer Staat gewesen, es hat eine föderalistische Tradition, die infolge der Vertreibungen nach 1945 ordentlich durchmischt wurde. Eine zweite intensive Durchmischung fand durch die soziale und regionale Mobilität statt. Ich lebe nicht mehr in meiner hessischen Heimat, sondern in Berlin. Aber ich habe immer noch die weiche Aussprache, die für den Oberhessen typisch ist. Insofern bin ich ein Hesse geblieben, aber nur zum Teil. Zum Teil bin ich Berliner geworden. Dass ich Deutscher bin, haben wir schon festgestellt. Und dann bin ich noch Europäer. Es gibt also gar nicht die eine Identität. Jetzt, wo Trump neuer Präsident der USA ist, werden sich viele Europäer wieder stärker als Europäer fühlen, und der Begriff des Westens wird an Bedeutsamkeit verlieren. Es ist ein permanenter Prozess, der auch von Situationen abhängt.
Ist der Wunsch nach einer intakten Nation auch eine Reaktion auf eine komplexe Welt und die ausbleibenden Vorteile einer Globalisierung, wie sie oft versprochen wurden?
Für Verlierer der Globalisierung ist die Nation gewissermaßen die Garantie der sozial-staatlichen Versorgung. Das heißt, sie tun das nicht einfach, weil sie die Nation so schätzen, sondern weil diese ihre Versicherung in schlechten Zeiten ist. Gerade in komplexen Situationen braucht man Mittel des Halts und der Vergewisserung. Deshalb können wir zurzeit die politische Sehnsucht nach einer kleinräumigeren und überschaubareren Welt beobachten. Das heißt: Man kann sich mehr Globalisierung zutrauen, je gewisser man seiner eigenen regionalen oder nationalen Identität ist. Die Bedeutung der Nation wird also nicht abnehmen, sondern zunehmen. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang jedoch, welchen Begriff von Nation wir zugrunde legen.
Welchen sollte man Ihrer Meinung nach zugrunde legen?
Eine Nation, die menschenfreundlich ist. Eine, die sich nicht durch Exklusion auszeichnet, sondern durch die Bereitschaft zur Inklusion. Eine, die dabei aber auch bereit ist, für gewisse Werte einzustehen. Und eine, die gut gemanagt ist – also ein Land, das dazu in der Lage ist, Wohlstand für seine Bürger bereitzustellen, und das nachhaltig. Wer ein Interesse daran hat, dass der Sozialstaat auch unter veränderten Rahmenbedingungen in Zukunft aufrechterhalten werden kann, der muss sich auch auf den Begriff der Nation einlassen.
Warum?
Die Bereitschaft, in ein System einzuzahlen mit dem Wissen, dass ich nie dieselbe Summe herausbekommen werde, macht unseren Sozialstaat aus. Die Bereitschaft, dies zu tun, ist auf der Grundlage einer erhöhten Zurechnung – „Das ist auch ein Deutscher“ und nicht irgendwie die Welt – wesentlich höher. Man konnte das in der Vergangenheit beobachten. Die „alten“ Bundesbürger waren im hohen Maße bereit, die neuen Bundesländer finanziell zu unterstützen. Aber als die Empfänger solcher Transfers nicht mehr Deutsche waren, sondern vermeintlich Griechen, war das deutlich anders. Es braucht also ein Gemeinschaftsgefühl, damit es mit der Solidarität klappt.
Titelbild: Hermann Bredehorst/Polaris/laif
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.