Familienkrach
Die EU-Staaten streiten lautstark, woher das Geld für den Kampf gegen die Corona-Krise kommen soll. Manche sprechen von einer Zerreißprobe
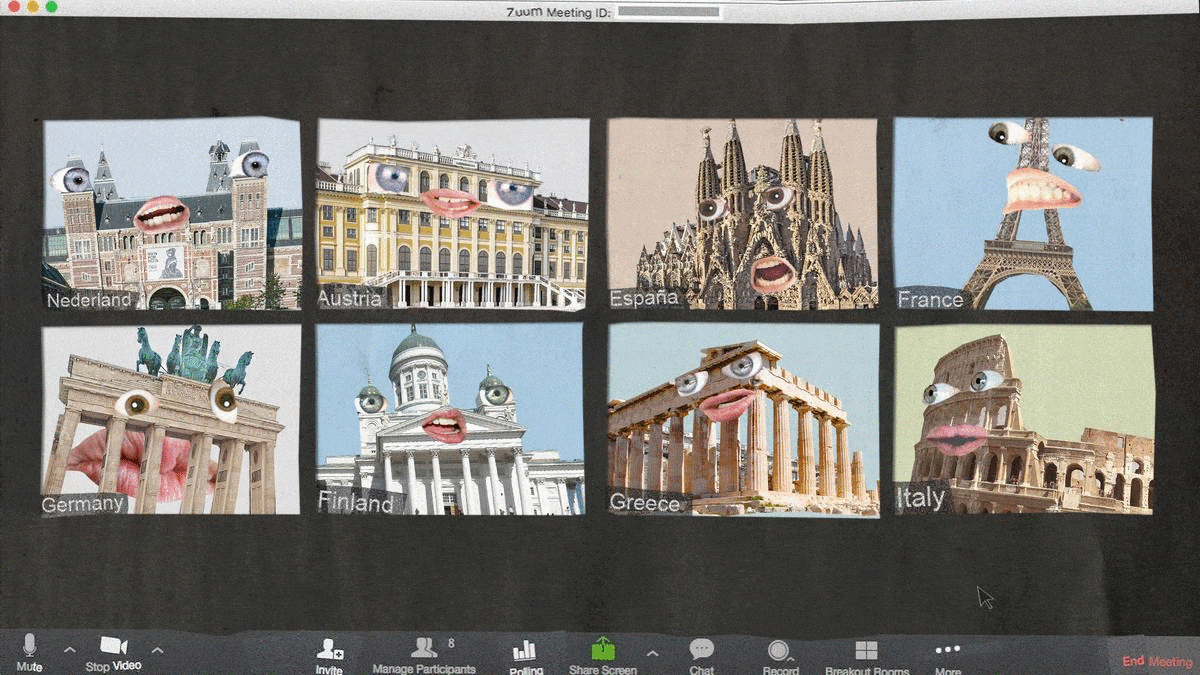
Von Rom bis Tallinn und von Warschau bis Lissabon: Die Corona-Krise trifft alle EU-Staaten. Doch werden sie die wirtschaftlichen Folgen unterschiedlich stark zu spüren bekommen. In Telefon-Konferenzen diskutieren die Staats- und Regierungschefs und die EU-Kommission, wie sie eine große Wirtschaftskrise abwenden können. Ein Wiederaufbaufonds, ähnlich dem Marshallplan nach dem zweiten Weltkrieg, gemeinsame Schulden machen, den Rettungsschirm aus der Finanzkrise von vor zehn Jahren wiederbeleben? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten für euch zusammengestellt.
Die Pandemie bringt die Wirtschaft überall in Europa in große Schwierigkeiten. Um alle dabei zu unterstützen, die Krise zu stemmen, hat die EU bereits einige Schritte unternommen und zum Beispiel die Schuldenregeln ausgesetzt. Auf die hatten sich die EU-Staaten als Teilnahmevoraussetzung an der Währungsunion geeinigt – bei ihrer Einhaltung sollten solide Staatsfinanzen gewährleistet sein. Jetzt in der Krise gelten die Regeln nicht, und die Mitgliedsländer dürfen mehr neue Schulden aufnehmen.
Die EU-Kommission hat ein 500 Milliarden Euro schweres Rettungspaket beschlossen, mit dem notleidende Staaten und Unternehmen Kredite von der Europäischen Investitionsbank und dem Europäischen Rettungsschirm erhalten können. Zudem hat man sich auf ein europäisches Kurzarbeiterprogramm geeinigt, um Arbeitnehmer und Selbstständige finanziell zu unterstützen. Die ersten Hilfspakete könnten bereits zum 1. Juni zur Verfügung stehen.
Ein Vorwurf lautet: Die Mitgliedstaaten hätten es verschlafen, Italien sofort zur Hilfe zu eilen, als die Krise dort eskaliert ist. Einige in Italien nehmen das den anderen EU-Staaten übel: Wenn es ernst wird, ist jedes Land trotz EU-Gemeinschaft auf sich allein gestellt, so der Eindruck dort.
Außerdem geht das, was bisher beschlossen wurde, einigen Mitgliedern noch nicht weit genug. Sie fordern daher neue Kriseninstrumente. Aber die hitzigen Streitereien der Regierungschefs haben bei manchen das Gefühl weiter verstärkt, dass die gegenseitige Hilfe ihre, im wahrsten Sinne des Wortes, Grenzen hat.
Inzwischen gibt es aber zumindest den ersten Ansatz einer Lösung. Ein Kernpunkt ist, dass die gemeinsamen Hilfsmaßnahmen zu einem großen Teil über das EU-Budget abgewickelt werden sollen statt über die einzelnen Haushalte der Mitgliedstaaten.
Das Budget der EU besteht vor allem aus Zahlungen der Mitgliedstaaten – anteilig auf der Grundlage des Bruttonationaleinkommens (BNP) – und hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Das aktuelle, für 2014 bis 2020, beträgt knapp 960 Milliarden Euro. Das klingt viel, ist aber nur rund ein Prozent des BNP der EU-Mitgliedstaaten. Jetzt überlegt man, den Haushalt für einige Jahre zu verdoppeln: Jeder Staat würde dann zwei Prozent seines BNP in den Brüsseler Topf einzahlen.
Denn die EU will mehr Geld aufwenden, um die Krise zu stemmen – und zum Beispiel einen Fonds auflegen, der den Wiederaufbau Europas nach der Krise finanziert. Das soll eine Art Marshallplan gegen die wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns sein.
Alle Details für den Wiederaufbaufonds sind noch offen. Weil sich die EU-Regierungschefs nicht einigen können, haben sie den Ball an die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gespielt. Die sagte, es ginge dabei „nicht um Milliarden, sondern um Billionen Euro“. Also um eine Zahl mit zwölf Nullen. In der kommenden Woche wird sie einen Vorschlag vorlegen. Dann wird die Diskussion zwischen den Regierungschefs noch mal richtig losgehen.
Der große Streitpunkt dabei ist, wie mit den Schulden umgegangen werden soll, die während der Krise entstehen. Die EU-Mitgliedstaaten sind sich uneins, ob Geld aus dem Wiederaufbaufonds als Darlehen oder Zuschuss verteilt wird – also ob die Staaten das Geld wieder zurückzahlen müssen oder nicht.
Die Diskussion schließt direkt an das Thema Corona-Bonds an, das in den vergangenen Wochen für Zündstoff gesorgt hat.
So wie Einzelpersonen können auch Staaten einen Kredit aufnehmen. Dafür gehen sie aber nicht zu einer Bank, sondern geben Anleihen heraus. Das sind Wertpapiere, die theoretisch von jedem gekauft werden können. Der Käufer einer Anleihe hat nach einer festgelegten Zeit Anspruch auf Rückzahlung – und bekommt Zinsen, so wie das bei normalen Krediten funktioniert. Wie hoch diese Zinsen sind, hängt davon ab, wie glaubwürdig der Staat ist, der die Anleihe herausgibt. Wenn er in finanziellen Schwierigkeiten steckt, muss er höhere Zinsen zahlen, weil das Risiko dann größer ist, dass der Käufer sein Geld nicht zurückbekommt.
Zum Beispiel muss Italien sehr viel mehr Zinsen zahlen als etwa Deutschland, das als zahlungskräftiger gilt. In einer Krise wie jetzt wird es für Italien deshalb eng. Also will es gemeinsam mit den anderen EU-Staaten Bonds („Corona-Bonds“) ausgeben, sprich: Anleihen mit einem für alle EU-Länder gleichen festen Zinssatz. Denn wenn Länder wie Deutschland mithaften, können die anderen EU-Mitglieder ebenfalls Geld zu niedrigen Zinsen bekommen. Auch Spanien, Frankreich und einige weitere fordern so ein Modell. Aber Deutschland, die Niederlande, Finnland und Österreich lehnen es ab, sodass es momentan so aussieht, als ob es keine Corona-Bonds geben wird.
Gemeinsame Schulden heißt: Die Zahlungskräftigen müssten auch für Zahlungsausfälle anderer Mitgliedstaaten haften. Einige, allen voran die Niederlande und Deutschland, wollen das nicht und begründen das damit, dass sie keine Kontrolle über die Ausgaben der anderen haben.
Dahinter steckt ein altes Problem der EU: Die Staaten wollen über ihre Haushalte jeweils selbst entscheiden und haben deshalb auch keine Mitsprache bei den anderen. Daher tun sie sich schwer damit, gemeinsame Schulden aufzunehmen und gegenseitig für sich zu haften.
Außerdem seien für die Aufnahme von gemeinsamen Bonds Änderungen der EU-Verträge nötig. Das würde zu lange dauern, um jetzt akut zu helfen, meint Bundeskanzlerin Merkel und verweist darauf, dass Geld aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) sofort verfügbar wäre.
Das ist ein Instrument, das 2012 in der Euro-Krise erfunden wurde, um überschuldeten Euro-Staaten Kredite zu geben und so ihre Zahlungsfähigkeit zu sichern. Dieser Rettungsschirm verfügt noch über 410 Milliarden, auf die sofort zugegriffen werden kann.
Während der Euro-Krise waren ESM-Kredite an strikte Reformauflagen und Sparmaßnahmen geknüpft, wie sie damals etwa Griechenland akzeptieren musste. Deshalb hat der ESM weiterhin ein sehr schlechtes Image in Südeuropa. Dieses Mal würde das Geld ohne solche Bedingungen verliehen – darauf haben sich die Staaten bereits geeinigt.
Auch mit dem EU-Budget könnten gemeinsame Bonds abgesichert werden und krisengebeutelte Staaten von günstigeren Konditionen profitieren. So würden zwar trotzdem die Mitgliedstaaten geradestehen müssen. Aber im Unterschied zu den Corona-Bonds haften die Staaten nicht unbegrenzt, sondern nur gemäß ihrem eigenen Anteil am EU-Budget.
Wo das Geld für den Wiederaufbau aber genau herkommen soll und ob die Staaten es später zurückzahlen müssen, ist noch nicht geklärt. Jedenfalls hat die Debatte ordentliche Sprengkraft. Einige, unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Premierminister Giuseppe Conte, sprechen von einer Zerreißprobe für die EU.
In diesem Kontext vom Ende der EU zu sprechen ist erst einmal vor allem ein politischer Kniff, der Druck und viel Aufmerksamkeit erzeugt. Was für viele hängen bleiben könnte: EU-Staaten unterstützen sich nicht bedingungslos. Das könnte euroskeptischen Parteien bei den nächsten Wahlen in die Hände spielen. Denn viele Menschen, unter anderem in Italien, Spanien und Frankreich, sind sehr enttäuscht von ihren europäischen Nachbarn. Die von der Krise hart getroffenen Staaten prangern den knauserigen Umgang an, während weniger gebeutelte Staaten um ihre politische Unabhängigkeit fürchten. Die EU-Institutionen versuchen einstweilen, zwischen den streitenden Mitgliedstaaten zu vermitteln. Es gehe jetzt darum, die richtige Balance zu finden, sagt die Kommissionspräsidentin von der Leyen. Einfach wird das bestimmt nicht.
GIF: Renke Brandt
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.

