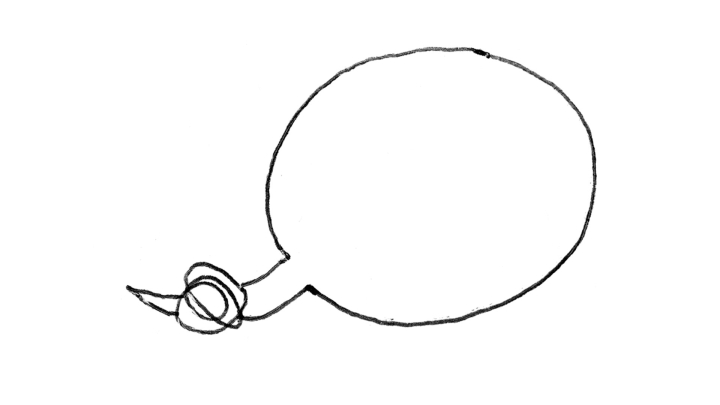Grenzerfahrungen
Teil 3: Jay (29) ist DJ und Sozialpädagoge – wenn sein Körper nicht in den Shutdown geht
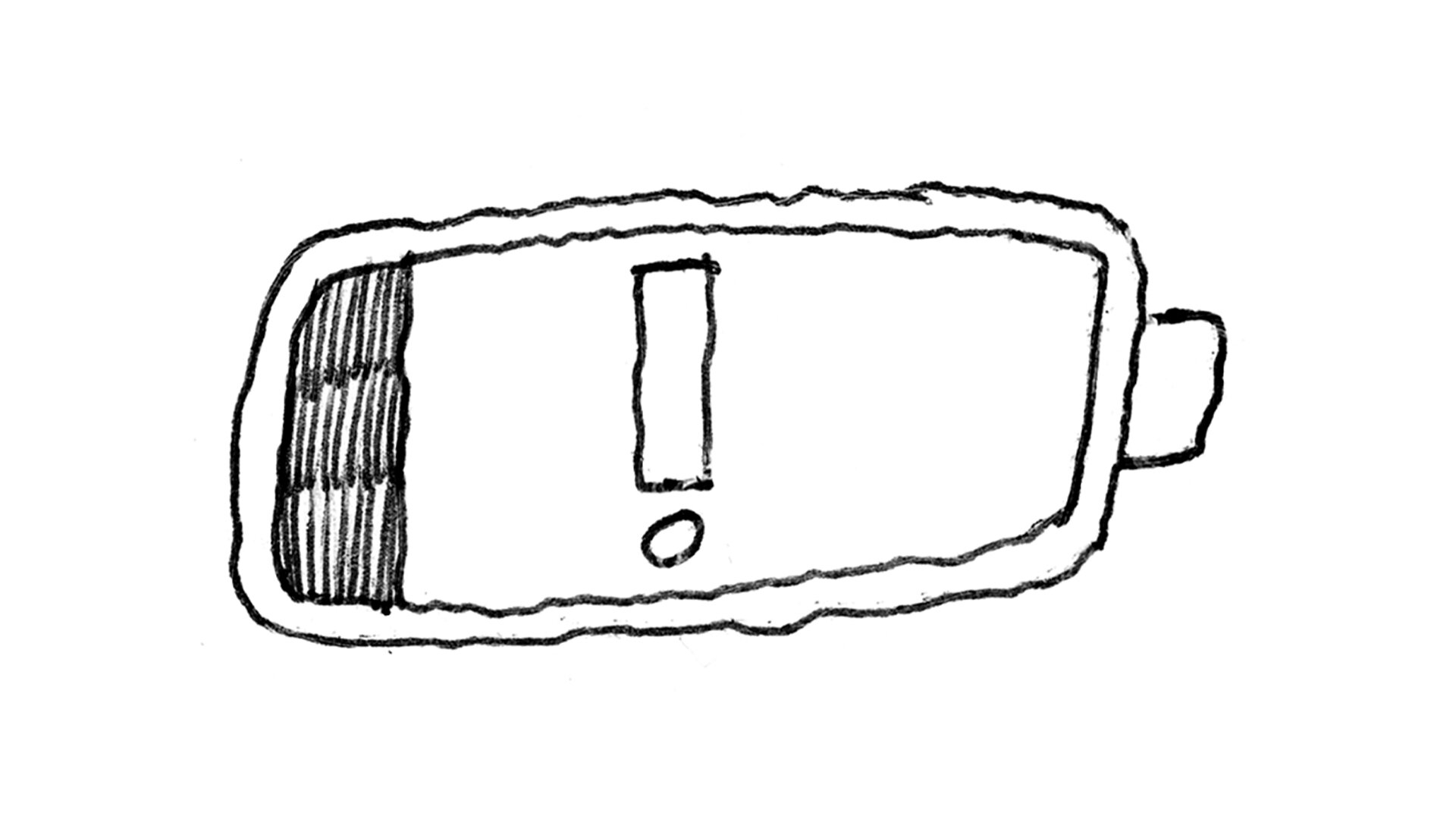
Das Leben, das ich kannte, war von einem Tag auf den nächsten vorbei. Seit acht Jahren lebe ich in einem Körper, der aussieht wie meiner, aber nicht mehr funktioniert.
Mein Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) könnt ihr euch vorstellen wie eine unaufhörliche drückende Grippe. Die befällt das ganze System: Stoffwechsel, Immunsystem, Nervensystem. Mein Körper ist dauerhaft erschöpft. Ausgelöst hat meine Erkrankung ein schwerer Infekt. Ich hatte Stress auf der Arbeit und habe mich nicht genug geschont. Damals wusste ich nichts von chronischer Fatigue, trotzdem war mir klar, dass ich etwas Schwerwiegendes habe.
„Mein Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) könnt ihr euch vorstellen wie eine unaufhörliche drückende Grippe. Mein Körper ist dauerhaft erschöpft“
Lasse ich mich in guten Phasen auf einen Abend mit Freunden ein oder gehe in die Boulderhalle, zahle ich danach die Rechnung. Dann fühle ich mich tagelang wie verkatert, ohne einen Tropfen Alkohol getrunken zu haben. Um die Symptome zu mildern, meditiere ich und gehe so früh schlafen wie ein Kleinkind. Es fühlt sich an, als hätte man mich in einen Kokon gezwängt: Ich sehe, was das Leben bereithält, lebe aber selbst in einem viel zu engen Korsett aus Vorsicht und Verzicht.
Nicht nur die unmittelbaren Symptome schränken mich ein. Nichtbetroffene nehmen meine Erkrankung oft nicht ernst, sogar manche Mediziner. Nach dem ersten Jahr mit starken Beschwerden meinte ein Arzt zu mir, ich solle mich einfach zwei Wochen vegan ernähren und mir eine Freundin suchen, dann ginge es bestimmt ratzfatz besser. Wegen solcher Vorurteile möchte ich hier nicht meinen echten Namen lesen. Ich will nicht der chronisch Kranke sein, wenn mich jemand googelt.
Das hätte auch Nachteile bei der Jobsuche – mit Fatigue eine harte Angelegenheit. Nach anderthalb Jahren wollte ich wieder vorsichtig anfangen zu arbeiten. Ich bewarb mich für einen Minijob: Meine Aufgabe wäre nichts weiter gewesen, als eine Handvoll Mitarbeitende morgens mit dem Van zur Arbeit zu fahren und am Nachmittag wieder abzuholen. Zwei kurze Fahrten in einer Kleinstadt. Dazwischen Pause.
Im Bewerbungsgespräch erwähnte ich, dass ich eine gesundheitlich herausfordernde Zeit hinter mir hatte. Fast schockiert fragte der Personaler: „Wollen Sie damit sagen, dass Sie nicht belastbar sind?“ Alles in mir wollte antworten: „Genau das will ich sagen. Ich bin nicht stark belastbar. Warum sollte ich mich mit einem abgeschlossenen Studium sonst auf einen Minijob wie diesen bewerben?“ Ich beließ es bei einem „Vermutlich bin ich im Moment nicht so belastbar, wie ich es mal war“. Von der Firma habe ich nie wieder gehört.
„Nach dem ersten Jahr mit starken Beschwerden meinte ein Arzt zu mir, ich solle mich einfach zwei Wochen vegan ernähren und mir eine Freundin suchen“
Was für viele schwer vorstellbar ist: Es gibt kaum Momente, die losgelöst sind von meinem erschöpften Körper. Neulich war ich in einem Museum in Wien. Und hätte nichts lieber getan, als mir die Ausstellung anzuschauen. Obwohl es gesundheitlich einer der besseren Tage war, schossen ständig Erschöpfungssymptome zwischen die Kunst und mich. Es ging einfach nicht.
Seitdem habe ich diesen bescheidenen Wunsch: einen Kurzurlaub von meiner Erkrankung. Zwei Tage mit dem Körpergefühl von früher. An einem besonders schlimmen Tag habe ich zu einem guten Freund gesagt, was ich schon seit einer Weile dachte: „Ich möchte so nicht weiterleben.“
Ausgesprochen klang es erschreckend, wir haben beide geweint, und das hat gutgetan. Darum möchte ich darüber sprechen. Allein ein Grundwissen zu chronischer Fatigue macht es Betroffenen leichter. Zynisch, aber die Pandemie hat geholfen: Viele leiden unter Long Covid. Die Leute sprechen über Fatigue, das Verständnis wächst, dass ein Erschöpfungssyndrom nicht verschwindet, indem man an die frische Luft geht und „sich zusammenreißt“. Ich hoffe, dass weiter Geld in die Forschung fließt und Therapien entwickelt werden. Allein in Deutschland haben eine Viertelmillion Menschen ME/CFS. Für uns muss doch mehr zu machen sein?
Auch andere gesellschaftliche Vorstellungen erschweren chronisch Erschöpften das Leben, zum Beispiel klassische Rollenbilder. Ich stinke in vielem ab, was vermeintlich „echte“ Männer ausmacht. Wenn etwas Schweres getragen werden muss, ruft es wie ein Naturgesetz von irgendwoher: „Ah, starker Mann, pack mal mit an!“ Leuten, die ich nicht gut kenne, sagen zu müssen, dass ich das leider nicht kann, fällt mir irre schwer. Das bremst mich auch beim Daten, eigentlich suche ich gar nicht erst nach einer Partnerin. Selbst wenn ich mal einen guten Tag habe, also die Kraft, eine Frau kennenzulernen, kickt sofort die Sorge, dass sie mich eh nie als Partner wollen könnte, wüsste sie um meine Fatigue.
Illustration: Nadine Redlich
Dieser Beitrag ist im fluter Nr. 90 „Barrieren“ erschienen. Das ganze Heft findet ihr hier.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.