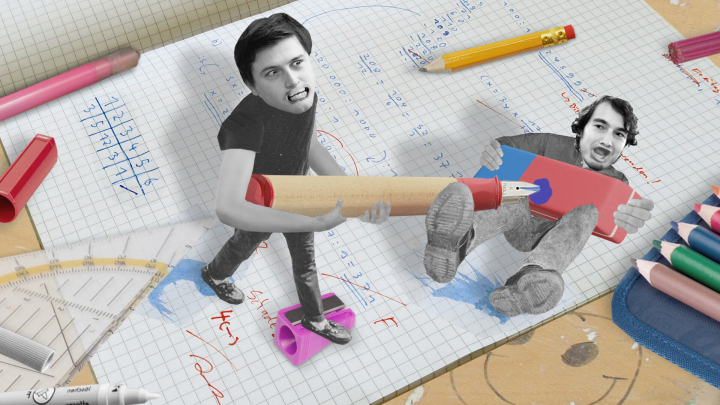Das liegende Klassenzimmer
Millionen Schüler lernen zuhause. Ist der Onlineunterricht eine neue Freiheit oder deprimierendes Absitzen? Berichte aus vier Kontinenten
Plötzlich kommt die Schulleitung rein und schickt alle nach Hause: Auf der ganzen Welt haben Schüler*innen solche Situationen im Pandemie-Jahr 2020 erlebt. Was viele zunächst feierten, als wäre gerade „Hitzefrei“ verkündet worden, wurde aber schnell zur Belastungsprobe. Schüler*innen aus Brasilien, China, Deutschland und Nigeria erzählen, wie sie mit dem Onlineunterricht zurechtkommen.
„Ich wusste gar nicht mehr, wie ich eine Straße überquere, ohne von einem Auto überfahren zu werden“

Luiza (17) aus Osasco, Brasilien
Brasilien ist mit am stärksten von der Pandemie betroffen: Mehr als 160.000 Menschen sind durch das Virus gestorben. Seit April lernt Luiza zuhause, das Haus hat sie von März bis Juni nicht verlassen. Erst Ende Juli gab es Lockerungen und die Geschäfte sind wieder offen.
Seit August gebe ich selbst Onlineunterricht für jüngere Schüler meiner Schule. Für den Test, den ich machen musste, um den Job zu bekommen, war ich seit langem mal wieder draußen. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich eine Straße überqueren sollte, ohne von einem Auto überfahren zu werden.
Seit acht Monaten tun wir alles, um sicher zu sein. Tausende sterben an Corona, vor allem im Norden des Landes: in Cuiabá oder Manaus. Brasilien ist kein Erste-Welt-Land, hier kann fast niemand seinen Job im Homeoffice machen.
Mein Alltag ist langweilig: Ich wache auf, mache Hausaufgaben, esse zu Mittag, nachmittags ist Onlineunterricht. Das war’s. Ich vermisse es, zur Schule zu gehen. Ich bin da gerne, verbringe normalerweise den größten Teil meines Tages dort. Wir benutzen jetzt Onlineplattformen. Am Anfang waren wir alle unsicher – Lehrer und Schüler: Wie verschicke ich die Aufgaben, wie mute ich das Mikro, wo ist der Chat? Jetzt ist das Routine.
Unsere Familie ist während der Pandemie größer geworden: Meine Schwester wurde Ende Juni geboren. Ich hatte gerade Schule, als meine Mutter mich rief. Ich schaltete den Computer aus und rief meinen Vater an. Nur Leute über 18 durften meine Mutter ins Krankenhaus begleiten – wegen des Virus.
„Man nennt uns ‚Digital Natives‘, aber das gilt nur für Social Media“
Erjon (15) aus Berlin-Neukölln, Deutschland
Wegen der Kontaktbeschränkungen im März wurden Berliner Schüler*innen von heute auf morgen digital unterrichtet. Seit September ist Erjon wieder täglich in der Schule. Gleichzeitig steigt in Berlin die Zahl der Infizierten.

Mitte März kam plötzlich der Direktor in den Unterricht geplatzt und sagte, dass wir keine Schule mehr haben. „Cool!“, habe ich gedacht. Aber dann zog es sich in die Länge. Ich wollte einfach wieder hin und mein normales Leben weiterführen.
Die Lehrer haben uns sehr viele Aufgaben in ein Moodle, also eine digitale Lernplattform, gestellt oder per Mail geschickt. Es ist schwieriger voranzukommen, wenn kein Lehrer dabei ist. Sie konnten auf unsere Mails mit Fragen nicht so schnell antworten. Mein Klassenlehrer hat mich auch mal angerufen und gefragt, wie es mir geht und welches Fach besonders schwer ist. Er beantwortet Fragen auch in unserer WhatsApp-Klassengruppe.
In Mathe hatten wir Videounterricht. Das war zuerst ein bisschen chaotisch mit 27 Schülern. Manche hatten kein Zugang zum Internet, manche konnten sich Tablets von der Schule leihen. Man nennt uns „Digital Natives“, aber das gilt nur für Social Media. Ich wusste nicht mal, wie man Mails mit Anhang verschickt oder bei Word etwas ändert. Ich hatte ja nur mal ein halbes Jahr Informatik.
In den vergangenen Monaten ist viel Negatives im Internet passiert. Auf TikTok sehe ich viele beleidigende, rassistische Kommentare. Oft schreibe ich den Personen, gegen die sich der Hate richtet. „Hör nicht drauf“, baue ich sie auf. Eins meiner TikToks hat schon eine halbe Millionen Klicks. Das motiviert mich, während die Schule gerade eher runterzieht. Seit den Sommerferien sind wir wieder jeden Tag dort. Wir schreiben wöchentlich mehrere Tests, müssen wohl viel nachholen. Dieses Jahr mache ich meinen Mittleren Schulabschluss. Ich habe jetzt drei Mal die Woche Nachhilfe. Dann habe ich erst um 18 Uhr Schluss, das ist richtig viel alles.
Seit Ende Oktober müssen wir überall in der Schule Masken tragen und dürfen nur noch draußen Sport machen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Viele Schulen in Berlin sind jetzt wieder geschlossen. Letztens war bei uns der ganze 11. Jahrgang in Quarantäne.
„Jeden Morgen müssen wir am Schultor unsere Temperatur messen lassen“

Yelin und Yesen (18) aus Schanghai, China
Von Ende März bis Mai hatten die Zwillinge Onlineunterricht. Seitdem gehen sie wieder in die Schule.
Jeden Morgen müssen wir am Schultor unsere Temperatur messen lassen. Aber andere Sicherheitsvorkehrungen sind nicht mehr so streng. Wir müssen zum Beispiel im Unterricht keine Masken mehr tragen. Als im Januar der Lockdown verhängt wurde, waren bei uns gerade Winterferien. Wegen Corona wurden sie verlängert. Von Ende März bis Mai hatten wir dann Onlineunterricht. Einige unserer Klassenkameraden mochten das nicht besonders, aber für uns war es eigentlich positiv. Einsamkeit kam nicht auf, wir haben ja uns.
Beim Onlineunterricht spart man sich den Schulweg. Wir konnten jeden Tag eine halbe Stunde später aufstehen und mit Pyjamas im Bett direkt vorm Computer sitzen. Das einzige Problem ist, dass wir sehr diszipliniert sein mussten. Wenn wir etwas nicht verstanden haben, mussten wir Screenshots machen und den Lehrer hinterher fragen. Denn in den ersten 30 Minuten lief ein Video, das der Lehrer vorher aufgenommen hatte. Erst dann ging er online und erklärte etwas. In der Mittagspause sind wir rausgegangen zum Ballspielen oder Seilspringen. Der Unterricht ging bis vier oder fünf, dann Hausaufgaben.
In den Schulferien haben wir Privatunterricht genommen – in Englisch und Mathe. In China ist das normal. Es ist wie ein kleiner Wettbewerb: Jeder will der Beste sein. Unsere Noten entscheiden darüber, was wir studieren können. Seit September sind wir offiziell Zwölftklässler. Es wird ernst. In der Corona-Zeit gab es in vielen Ländern Rassismus gegen Asiaten. Deswegen überlegen manche Schüler jetzt, lieber nicht im Ausland zu studieren. Wir wissen es noch nicht. Trotz der Probleme glauben wir, dass die Menschen nach der Pandemie mehr Zusammenhalt zeigen werden, besonders die jungen. Wir sind gespannt darauf, wie die Welt – und nicht nur in China – danach aussieht.
„In diesen Zeiten hilft mir mein Glaube. Ich bete und hoffe das Beste“
Faizah (17) aus Ibadan, Nigeria
Seit Anfang Mai finden Faizahs Seminare an der Uni nur noch online statt. Die Semesterferien sind wegen Corona ausgefallen.
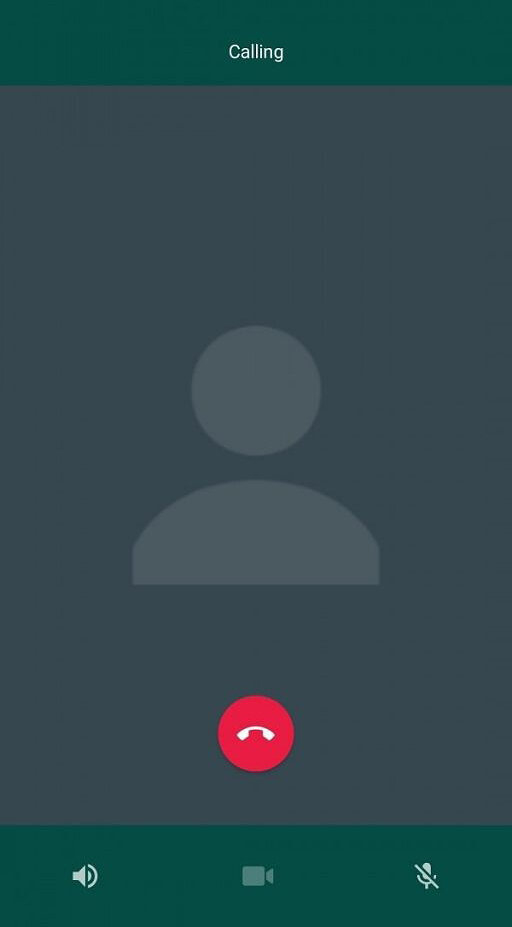
Die Onlinekurse meiner Uni fangen erst um elf Uhr an, aber ich stehe trotzdem um halb sechs auf – für das Morgengebet. Deshalb bin ich tagsüber oft müde und lege mich noch mal hin. Ich schlafe viel in der Corona-Zeit, lese Bücher, gucke Fernsehen und koche. Oft ist mir langweilig. Manchmal spiele ich mit meinen Brüdern, aber häufiger streiten wir.
Obwohl ich erst 17 bin, studiere ich schon Pharmazie. Ich war schnell. Das Fach habe ich gewählt, weil es gute Perspektiven bietet. Aber manches fällt mir nicht leicht, besonders Physik. Die Stunden verfolge ich über mein Smartphone. Den Onlineunterricht mag ich nicht wirklich, weil es schwieriger ist, Fragen zu stellen.
Wegen Corona mache ich mir große Sorgen. Die Zahl der Infizierten steigt von Tag zu Tag. Ich habe Angst, dass die Wirtschaft kollabiert. Und auch, dass ich nicht weiterstudieren kann. Trotz des Lockdowns sind draußen viele Menschen unterwegs. Sie gehen ihren normalen Geschäften und Aktivitäten nach, sie haben keine Wahl. Ich mache mir vor allem Sorgen um meine Großeltern, die in Lagos wohnen. Wir können nicht dorthin fahren, weil man nicht in andere Bundesstaaten reisen darf.
Beunruhigend finde ich neben der Corona-Krise auch andere Entwicklungen auf der Welt. Im Lockdown habe ich die amerikanischen Black-Lives-Matter-Proteste in den Medien verfolgt. Der steigende Rassismus gegen Schwarze ist ein großes Problem. In diesen Zeiten hilft mir mein Glaube. Ich bete und hoffe das Beste.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.