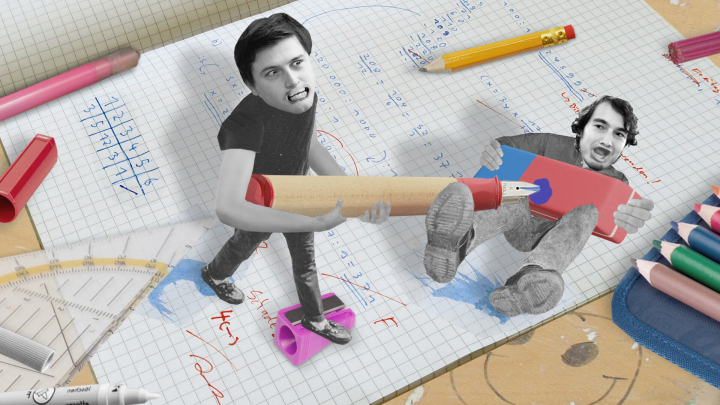Die Schulen-Bremse
Vor Jahren machte die Gewalt an der Rütli-Schule bundesweit Schlagzeilen. Mit sehr viel Geld wurden die Probleme dort anschließend behoben. Aber was ist mit all den anderen Schulen, die ähnliche Schwierigkeiten haben? Und ist Geld allein die Lösung?

Anke Schäfer macht sich Sorgen. In diesem Jahr hat der Berliner Senat ihrer Schule 50.000 Euro gestrichen. Deshalb muss die Schulleiterin jetzt mehrere Förderangebote ausfallen lassen. Etwa die individuelle Betreuung durch Lerncoaches oder einen Teil des natur- und werkpädagogischen Angebots. Auch für neue Lesebücher ist kein Geld mehr übrig. Aus Schäfers Sicht ist das fatal. Viele ihrer Schülerinnen und Schüler haben Förderbedarf, vier von fünf sprechen zu Hause kein Deutsch. Nicht alle Familien können ihre Kinder genügend unterstützen, beobachtet Schäfer. „In unserem Schulalltag geht es oft darum, das auszugleichen, was die Eltern nicht leisten. Das wird jetzt noch schwieriger.“
Die Grundschule am Fliederbusch liegt ganz im Süden von Neukölln. Auf der anderen Straßenseite beginnt die Siedlung Gropiusstadt, ein selbst für Neuköllner Verhältnisse raues Pflaster. Die meisten Schülerinnen und Schüler der Fliederbusch-Schule wohnen hier, oft wachsen sie in prekären Verhältnissen auf. Die Hälfte der Familien bezieht Transferleistungen, viele der Mütter sind alleinerziehend. Laut der Berliner Senatsverwaltung kommt es an den Schulen hier dreimal so oft zu Gewalttaten wie sonst in der Stadt.
„Wir haben Kinder, die verlassen die Grundschule nach der sechsten Klasse, ohne richtig lesen und schreiben zu können“
Konflikte gehören auch am Fliederbusch zum Schulalltag, erzählt Anke Schäfer, die selbst unterrichtet. Zurzeit häuften sich Auseinandersetzungen, bei denen es um Geschlechterrollen gehe. „Da kopieren die Kinder das, was sie zu Hause hören“, glaubt Schäfer. Viele Familien kommen aus osteuropäischen Staaten, aus der Türkei und aus arabischen oder afrikanischen Ländern. Wobei Schäfer betont, dass die Probleme weniger mit der Nationalität als mit dem Bildungsgrad der Eltern zu tun hätten. Im Unterricht und in der Schulsozialarbeit gehe es oft darum, die Grundlagen für gegenseitigen Respekt zu legen. Zu ihrem eigentlichen Auftrag kämen die Lehrerinnen und Lehrer selten. „Wir haben Kinder, die verlassen die Grundschule nach der sechsten Klasse, ohne richtig lesen und schreiben zu können.“
Spätestens seit dem Pisa-Schock 2001 ist bekannt, wie stark der Bildungserfolg in Deutschland vom sozialen Hintergrund der Schüler abhängt. Die Coronapandemie hat das noch verstärkt. Der jüngste nationale Bildungsbericht zeigt, dass Viertklässler aus einem privilegierten Elternhaus einen Leistungsvorsprung von einem ganzen Lernjahr oder mehr haben. Wer aus einer sozial benachteiligten Familie kommt, hat also nach wie vor deutlich schlechtere Chancen, einen Schulabschluss zu schaffen oder aufs Gymnasium zu kommen. Bildungsforscher beobachten, dass die Rolle des Elternhauses aktuell sogar weiter an Bedeutung gewinnt.
Zum Schulstart haben in Neukölln vier von zehn Kindern Sprachdefizite, bei mehr als jedem zweiten wird schulischer Förderbedarf festgestellt. Der Berliner Senat versucht, gegenzusteuern, indem er Schulen in sozial benachteiligter Lage zusätzliche Mittel überweist. Rund 18 Millionen Euro investiert die Stadt derzeit im Jahr, um die ungleichen Startchancen abzufedern. Wie die Mittel eingesetzt werden, bleibt den Schulen überlassen. Das können etwa Investitionen in die Schulsozialarbeit sein, in Kunst- oder Musikprojekte oder in Fortbildungen für Lehrkräfte und Eltern. Berlinweit profitiert mehr als jede dritte öffentliche Schule von der Förderung – in Neukölln sind es zwei von drei Einrichtungen. Ausschlaggebendes Kriterium für die Förderung ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler, deren Eltern von der Zuzahlung für Lernmittel befreit sind. LmB-Faktor heißt das im Schulsprech. In keinem anderen Berliner Bezirk ist er so hoch wie in Neukölln.
Auch die Grundschule am Fliederbusch erhält Gelder vom Senat. In diesem Jahr aber statt 80.000 Euro nur mehr knapp 30.000 Euro. Der Grund für die Kürzung ärgert Schulleiterin Schäfer noch heute. Um die zusätzlichen Gelder zu erhalten, müssen nämlich die Eltern einmal im Jahr in die Schule kommen und nachweisen, dass sie Anspruch auf staatliche Hilfe haben. Doch das letzte Mal sind viele nicht erschienen – die Schule verfehlte die nötige LmB-Quote von 50 Prozent. Anke Schäfer glaubt, dass das Wegbleiben auch mit Scham zu tun hatte. Für die Betroffenen sei diese Praxis eine unnötige Demütigung.
Viele Kinder erfahren Mobbing, Gewalt, Rassismus
Dabei sind die Herausforderungen für das Kollegium nicht kleiner geworden. Zumal, wie Schäfer betont, nur fünf ihrer 31 Lehrkräfte voll ausgebildete Pädagogen sind. Zu wenige, um den vielen jungen Quereinsteigern zur Seite stehen zu können. Und zu wenige, um all den anderen Aufgaben einigermaßen gerecht werden zu können. „Wir brauchen eigentlich viel mehr Personal, um die Lehrkräfte entlasten zu können“, sagen Ronald Blank und Sabine Folgmann, die am Fliederbusch die Ganztagsbetreuung organisieren. 15 Erzieherinnen und Erzieher stehen dafür bereit, das sei ordentlich. Aber aus Sicht von Blank und Folgmann bräuchten sie dringend auch Schulbegleiter und Therapeutinnen, Sonderpädagogen und zumindest eine Schulpsychologin. Denn viele Kinder hätten Erfahrung mit Mobbing, andere mit Gewalt in der Familie. Gleichzeitig nehmen die besonderen Förderbedarfe für Autismus oder Asperger-Syndrom an der Schule zu: „Um wirklich auf alle Kinder eingehen zu können, fehlen uns die Ressourcen“, sagt Folgmann.
Auch Adrian de Souza Martins beobachtet, dass viele Lehrkräfte überlastet sind. Mehrere Jahre hat er als sogenannter Respekt Coach eng mit Berliner Schulen zusammengearbeitet, seit fünf Jahren koordiniert er das Projekt beim Internationalen Bund (IB) für den Bezirk Neukölln. Aktuell arbeiten de Souza Martins und sein Team mit vier Schulen zusammen, deren Schülerinnen und Schüler mehrheitlich aus muslimischen Familien kommen. Die Probleme seien dort dieselben wie überall sonst in Deutschland, betont er. Was ihm in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch zu kurz kommt: Die meisten Jugendlichen mit Migrationsgeschichte erfahren tagtäglich Rassismus, Ausgrenzung und Ablehnung – auch in den Schulen. Die Lehrkräfte zu sensibilisieren, dass sie Verantwortung für den Abbau von Diskriminierungen tragen, das sei Ziel des Projekts.
Als Beispiel nennt der Politikwissenschaftler den Umgang mit den Attentaten von Hanau. „Ich habe an einer Schule erlebt, wie eine Schweigeminute für einen ermordeten Lehrer in Frankreich gehalten wurde, nicht aber für den zehnfachen rassistischen Mord, der in Deutschland verübt wurde.“ Es könne niemanden überraschen, wenn sich Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte dann an dieser Schule nicht voll akzeptiert fühlten. Ähnlich unsensibel gingen Schulen oft auch mit religiösen Feiertagen um. Einerseits müssten an Weihnachten alle Engel basteln, das muslimische Zuckerfest hingegen werde ignoriert. Ein großes Problem seien aus seiner Sicht zudem Diskriminierungen vonseiten des Schulpersonals. „Wir erleben zwar, dass sich sehr viele Lehrkräfte in Neukölln für einen diskriminierungsfreien Raum engagieren und ihre Schülerinnen und Schüler schützen wollen.“ Damit die Schule ein sicherer Ort werde, müsse das ganze Kollegium mitziehen. Das sei aber nicht immer der Fall.
Die Respekt Coaches erstellen deshalb gemeinsam mit den Schulen Präventionskonzepte für Angehörige marginalisierter Communitys und unterstützen die Jugendlichen in ihren Identitätsprozessen. „Viele von ihnen sind aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihrer Sprache oder der angenommenen Religionszugehörigkeit stigmatisiert“, stellt de Souza Martins fest. Aber nur wer sich anerkannt fühle, nehme auch gesellschaftlich teil.
Was die Ablehnung mit jungen Menschen macht, hat Ender Çetin selbst erlebt. Der heute 47-Jährige ist in Neukölln aufgewachsen, seine Familie stammt aus der Türkei. Der Erziehungswissenschaftler und Theologe erinnert sich, wie stark er sich in seiner Jugend ausgegrenzt gefühlt hat. „Meine Freunde und ich sind ja alle in Deutschland geboren, trotzdem haben wir uns als Ausländer gefühlt.“ Irgendwann hätten sie diese Identität aus Protest nach außen getragen. Bei heutigen Jugendlichen erkennt Çetin einen ähnlichen Reflex, nur mit einem Unterschied: „Jugendliche mit Wurzeln in der Türkei, Bosnien oder arabischen Ländern werden nicht mehr als Ausländer gelesen, sondern als Muslime.“ Aus Çetins Wahrnehmung nähmen viele junge Menschen in Neukölln deshalb aus Protest eine „pseudoreligiöse“ Identität an. Die Jugendlichen seien ja heute nicht religiöser, sie nutzen nur verstärkt religiöse Vokabeln. Zum Beispiel Wallah – eine Schwurformel, die „bei Gott“ bedeutet.
Der Einfluss der Eltern beschäftigt die Polizei
Çetin weiß, wovon er spricht. 15 Jahre lang war er Imam der Neuköllner Şehitlik-Moschee. Mittlerweile arbeitet Çetin in der Extremismusprävention, besucht im Jahr weit über 200 Berliner Schulklassen, meist begleitet ihn ein Rabbiner. Dort thematisiert er Vorbehalte: die der muslimischen Community gegenüber Juden, die oft für den Staat Israel geradestehen müssen, und die der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Muslimen. Dass die Schulen sensibler mit der religiösen Vielfalt sein könnten, nimmt Çetin sehr wohl wahr. Er nimmt aber auch die Eltern in die Pflicht. „In vielen Neuköllner Communitys ist die Vaterrolle ein Problem“, sagt Çetin und zählt auf: die Tabuisierung der Sexualität, vor allem bei Mädchen. Die Vorstellungen von Familienehre. Die fehlende Unterstützung der Kinder beim Lesen und bei den Hausaufgaben. „All das führt dann zu Ärger in der Schule.“ Im schlimmsten Fall zu Mobbing, sexuellen Übergriffen oder anderer Gewalt.
Der Einfluss des Elternhauses beschäftigt auch die Berliner Polizei. Vor zwei Jahren hat sie ihre Präventionsarbeit erweitert. Nun gibt es für den südlichen Teil des Ortsteils Neukölln, in der die Jugendgewalt verstärkt auftritt, ein dreiköpfiges Jugendschutzteam. Nach jedem Gewaltvorfall an einer Schule führen die Polizisten Gespräche mit dem oder der tatverdächtigen Jugendlichen und vor allem auch den Eltern. „Normenverdeutlichendes Gespräch“ heißt das. Was das Jugendschutzteam beobachtet: Die meisten Kinder und Jugendlichen, die in der Schule mit aggressivem Verhalten auffallen, haben zu Hause selbst Schlimmes erlebt. Auch an der Grundschule am Fliederbusch gibt es Fälle von häuslicher Gewalt. Schulleiterin Schäfer und ihr Kollegium bringen daher alle Beteiligten an einen Tisch: Eltern, Pädagoginnen, Vertreter von Beratungsdiensten und Jugendamt. Zudem werden Eltern zweimal im Jahr zu Bilanzgesprächen eingeladen. Und künftig sollen auch pädagogische Nachmittage im Beisein der Eltern stattfinden. „Wir haben einen Schritt Richtung Familienarbeit gemacht“, sagt Schäfer.
Illustration: Olivier Kugler
Dieser Beitrag ist im fluter Nr. 88 „Neukölln“ erschienen. Das ganze Heft findet ihr hier.
Dieser Text wurde veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-NC-ND-4.0-DE. Die Fotos dürfen nicht verwendet werden.